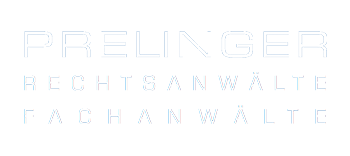Subjektbezogene Schadensbetrachtung im Regress des Sozialversicherungsträgers - Prelinger, Fachdienst Zivilrecht - Leitsätze mit Kommentierung (LMK) 2025, Heft 2 (Besprechung des Urteils des BGH vom 9. Juli 2024 - VI ZR 252/23)
Im Regress der gesetzlichen Krankenkasse gemäß § 116 SGB X ist hinsichtlich der Krankenhauskosten umstritten, ob auch die gesetzliche Krankenkasse die für den Geschädigten geltenden Darlegungserleichterungen der „subjektbezogenen Schadensbetrachtung“ bei der Auslegung des Begriffs „erforderlich“ in § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB in Anspruch nehmen kann.
Im Rahmen der subjektbezogenen Schadensbetrachtung ist Rücksicht auf die spezielle Situation des Geschädigten, insbesondere auf seine Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie auf die gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten zu nehmen (BGH, Urt. v. 16.01.2024 – VI ZR 51/23 sowie BGH, Urt. v. 16.01.2024 – VI ZR 38/22). Der BGH erkannte nunmehr, dass dies auch für Personenschäden gilt (Urt. v. 08.10.2024 – VI ZR 250/22).
Für die Krankenkasse, die gemäß § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X nur den übergegangenen Anspruch des Geschädigten regressieren und daher nicht schlechtergestellt werden darf als dieser (vgl. BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10), drängt sich daher die Anwendung dieser Grundsätze in Regressen auf, bei denen ihnen die Prüfung der Krankenhausabrechnung gesetzlich untersagt ist. Denn aufgrund der horrenden Menge von ca. 18 Mio. Krankenhausabrechnungen pro Jahr dürfen die Krankenhausabrechnungen von den Krankenkassen nur äußerst eingeschränkt geprüft werden, insbesondere nur innerhalb der sog. quartalsbezogenen Prüfquoten von 5-15%, §§ 275, 275c Abs. 2 SGB V. Wegen des sich aus dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ergebenden Gesetzesvorbehalts dürfen Krankenkassen Gesundheitsdaten nur dann verwenden, wenn ihnen dieses ausdrücklich vom Gesetzgeber gestattet wurde. Daher können auch die Krankenkassen bei nicht prüfbaren Abrechnungen nicht mehr tun, als die Rechnung ungeprüft dem Schädiger in Rechnung zu stellen – wie es auch der Geschädigte als „Laie“ täte (vgl. Prelinger, jurisPR-MedizinR 12/2019 Anm. 3; Prelinger, VersR 2022, 1337, 1344; Prelinger, NZV 2024, 233, 236, Rn. 20 ff.). Das Berufungsgericht teilte diese Auffassung (OLG Naumburg, Urt. v. 06.07.2023 – 9 U 125/22).
Der BGH hat in der hier besprochenen Entscheidung jedoch die Anwendung der subjektbezogenen Schadensbetrachtung mit der Begründung verneint, dass der Geschädigte nur der „Verletzte“ sei. Zudem wurde unzutreffenderweise unterstellt, dass Krankenkassen eine Privilegierung erstrebten, obwohl sie nur die Gleichbehandlung mit dem Geschädigten fordern, der sich aber selbst auch auf die subjektbezogene Schadensbetrachtung berufen kann. Die Entscheidung ist auch in weiteren wesentlichen Punkten unzutreffend und daher insgesamt nicht haltbar. Scheinbar ist der BGH den Stimmen aus dem Lager der Haftpflichtversicherer etwas zu unkritisch gefolgt (vgl. Lang, RuS 2023, 930; Burmann/Jahnke, RuS 2023, 145; Seiler, VersR 2024, 188, 195; Burmann/Jahnke, RuS 2024, 184; Bähring/Liborius, NJW-Spezial 2024, 73; Möhlenkamp, VersR 2024, 209; Drewes, NZV 2024, 136; Bähring/Burmann/Jahnke/Liborius, NZV 2024, 158). Für die Haftpflichtversicherer ist die subjektbezogene Schadensbetrachtung ungünstig, da damit ggf. auch weitergehende Leistungen ersetzt werden müssen, die objektiv nicht erforderlich waren.
Die klagende gesetzliche Krankenkasse verlangt vom beklagten Haftpflichtversicherer aus gemäß § 116 Abs. 1 SGB X übergegangenem Recht Erstattung ihrer Kosten, die sie für die Krankenhausbehandlung ihres versicherten Mitgliedes bzw. Geschädigten aufzuwenden hatte.
Der Geschädigte wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die volle Haftung der Beklagten dem Grunde nach sowie die Schwere der Verletzungen des Versicherten, die eine stationäre ärztliche Behandlung notwendig machten, stehen außer Streit. Der geschädigte Versicherte befand sich nach dem Unfall zunächst in einem Universitätsklinikum und anschließend in einem Rehabilitationszentrum. Für die Behandlung im Universitätsklinikum bezahlte die Klägerin 57.524,84 Euro, für die Behandlung im Rehabilitationszentrum 35.846,51 Euro. Von den für die Behandlung im Universitätsklinikum geforderten Kosten hat die Beklagte einen Betrag von 48.664,74 Euro anerkannt. Eine weitere Zahlung wurde mangels prüffähiger Unterlagen abgelehnt. Die Klägerin meinte dagegen, die der Beklagten übersandten Abrechnungsdaten des Krankenhauses sowie die Krankenhausberichte seien zur Darlegung der Schadenshöhe ausreichend.
Das Landgericht gab der auf Zahlung des restlichen Betrags von 44.706,61 Euro sowie auf Zahlung von Zinsen und vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten gerichteten Klage statt. Das OLG Naumburg wies die Berufung der Beklagten mit Urt. v. 06.07.2023 (9 U 125/22) zurück.
Der BGH hat auf die Revision der Beklagten die Entscheidung des Oberlandesgerichts aufgehoben und wegen der noch offenen Beweisfragen die Sache zurückverwiesen.
Das angefochtene Urteil halte revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand. Mit der Begründung des Berufungsgerichts könne die noch streitige Klageforderung als Schadensersatzanspruch der Höhe nach nicht zuerkannt werden.
Um die Problematik verständlicher zu machen, sind die Besonderheiten der Gesetzeskonstruktion voranzustellen: Krankenkassen sind im Wege der sozialstaatlichen Daseinsvorsorge verpflichtet, vorab Verträge mit medizinischen und sonstigen Leistungserbringern abzuschließen, welche die durchgehende Versorgung der Versicherten bei Erkrankungen und Verletzungen sicherstellen und auch privatrechtsgestaltende Wirkung haben (BGH, Urt. v. 29.06.2004 – VI ZR 211/03; OLG Hamm, Urt. v. 23.06.2009 – 9 U 150/08; BSG, Urt. v. 03.11.1999 – B 3 KR 4/99 R – BSGE 85, 110, 112).
Kommt es zu einem Schadensereignis eines Versicherten (= Verletzten), aus dem diesem ein Schadensersatzanspruch gegen Dritte entsteht, so regelt § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X, dass ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz eines Schadens auf den Sozialversicherungsträger übergeht, soweit dieser aufgrund des Schadensereignisses „Sozialleistungen“ zu erbringen hat, die der Behebung eines Schadens der gleichen Art dienen und sich auf denselben Zeitraum wie der vom Schädiger zu leistende Schadensersatz beziehen. Der Anspruch des Geschädigten (= Verletzten) geht vorab bereits dem Grunde nach sofort im Zeitpunkt des Schadensfalls binnen einer logischen Sekunde auf die Krankenkasse über und umfasst alle künftigen Sozialleistungen, die sachlich und zeitlich mit den Schadensersatzansprüchen des Geschädigten kongruent sind. Dabei reicht selbst eine weit entfernte Möglichkeit des Eintritts solcher Tatsachen aus, aufgrund derer Versicherungsleistungen zu erbringen sein werden, soweit die Entstehung solcher Leistungspflichten nicht völlig unwahrscheinlich ist (BGH, Urt. v. 12.04.2011 – VI ZR 158/10 Rn. 8; BGH, Urt. v. 24.04.2012 – VI ZR 329/10; BGH, Urt. v. 12.04.2011 – VI ZR 158/10; BGH, Urt. v. 20.09.1994 – VI ZR 285/93). Dies umfasst sogar auch solche künftigen Sozialleistungen, deren inhaltliche Ausgestaltung durch Veränderungen im Leistungsgefüge erst später erfolgt, soweit eine als Grundlage für den Forderungsübergang geeignete Leistungspflicht des Sozialversicherungsträgers gegenüber dem Geschädigten überhaupt in Betracht kommt (BGH, Urt. v. 12.04.2011 – VI ZR 158/10 Rn. 8 m.w.N.). Der sofortige Anspruchsübergang dem Grunde nach dient damit dem Ausgleich der vom Sozialversicherungsträger künftig zu erbringenden Sozialleistungen (BGH, Urt. v. 17.10.2017 – VI ZR 423/16 Rn. 29).
Der sofortige Übergang dient auch dem Schutz der Versichertengemeinschaft, die vor nachteiligen Verfügungen des Geschädigten geschützt werden soll (BGH, Urt. v. 19.01.2021 – VI ZR 125/20; BGH, Urt. v. 17.10.2017 – VI ZR 423/16; BGH, Urt. v. 24.04.2012 – VI ZR 329/10). Ein Übergang der Höhe nach kann somit nicht erfolgen, dem Verletzten können binnen der logischen Sekunde noch keine konkreten Kosten (Schadenspositionen) entstanden sein. Der Anspruch des Geschädigten wird vorab sofort dem Grunde nach zum erst künftig der Höhe nach beim Sozialversicherungsträger entstehenden Schaden in Form der von diesem dem Geschädigten zu leistenden „Sozialleistungen“ gezogen, was zugleich eine Drittschadensliquidation erübrigt.
Die künftigen Sozialleistungen der Sozialversicherungsträger sind aber nicht uferlos zu ersetzen. Bei wertender Betrachtung handelt es sich nämlich bei diesen um einen normativen Schaden des Verletzten, dem die späteren Sozialleistungen des Sozialversicherungsträgers zugerechnet werden (BGH, Urt. v. 10.11.1998 – VI ZR 354/97 Rn. 12, 19). Ohne Annahme eines normativen Schadens liefe der Regress stets ins Leere (BGH, Urt. v. 22.11.2016 – VI ZR 40/16 Rn. 15). Daher regelt § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X, dass die spätere Sozialleistung des Sozialversicherungsträgers der Behebung eines Schadens der gleichen „Art“ dienen und sich auf denselben Zeitraum wie der vom Schädiger zu leistende Schadensersatz beziehen muss (zeitliche und sachliche Kongruenz; die zeitliche Kongruenz spielt bei der Problematik hier keine Rolle). Die sachliche Kongruenz besteht, wenn sich die Ersatzpflicht des Schädigers und die Leistungsverpflichtung des Sozialversicherungsträgers ihrer Bestimmung nach decken. Hiervon ist auszugehen, wenn die Leistung des Versicherungsträgers und der vom Schädiger zu leistende Schadensersatz dem Ausgleich derselben Einbuße des Geschädigten dienen. Es genügt, wenn der Sozialversicherungsschutz seiner Art nach den Schaden umfasst, für den der Schädiger einstehen muss. Es kommt nicht darauf an, ob auch der einzelne Schadensposten vom Versicherungsschutz gedeckt ist (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 14). Es geht somit grundsätzlich nur darum, ob die geltend gemachten Schadenspositionen überhaupt zu den vom Übergang erfassten abstrakten „Schadensarten“ gehören (Heilungskosten, Erwerbsschaden und vermehrte Bedürfnisse), die auch dem Geschädigten zustehen (BGH, Urt. v. 30.06.2015 – VI ZR 379/14).
Die hier maßgebliche Krankenbehandlung ist als Sachleistung grundsätzlich sachlich kongruent mit der Verpflichtung des Schädigers, dem Geschädigten die Heilungskosten zu ersetzen. Die Krankenhauskosten der gesetzlichen Krankenversicherung stellen Sachleistungen gemäß den §§ 2 Abs. 2, 12 Abs. 2, 13 Abs. 1 SGB V dar. Die Kosten ergeben sich aus den gemäß § 109 Abs. 4 Satz 3 SGB V i.V.m. § 7 KHEntgG und § 17b KHG abgeschlossenen und für alle Benutzer des Krankenhauses gültigen Versorgungsverträgen. Die Pflegesätze und die Vergütung für allgemeine Krankenhausleistungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KHG, § 8 Abs. 1 Satz 1 KHEntgG, § 14 Abs. 1 Satz 1 BPflV unabhängig vom Versichertenstatus für alle Benutzer des Krankenhauses einheitlich zu berechnen und für die Parteien des Krankenhausaufnahmevertrages sowie für die Abrechnung zwischen Sozialleistungsträgern und Krankenhäusern gleichermaßen bindend (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 15, 17 m.w.N.; BGH, Urt. v. 27.01.1954 – VI ZR 16/53 – BGHZ 12, 154, 155 f.; BGH, Urt. v. 09.11.1989 – IX ZR 269/87; zusf. Prelinger, NZV 2024, 233, 235).
Die Krankenkasse leistet somit dem Geschädigten die gesamte Heilbehandlung durch ihre medizinischen und therapeutischen Leistungserbringer als Sachleistung (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 10 m.w.N.; BGH, Urt. v. 29.06.2004 – VI ZR 211/03). Die Krankenkasse kann daher für diese „Sozialleistung“ vom Schädiger den Geldbetrag ersetzt verlangen, den sie an ihre jeweiligen Leistungserbringer zahlte (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 m.w.N.). Mit dem Begriff „Sozialleistung“ in § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X ist dieser konkret vom Schädiger zu ersetzende Schaden des Sozialversicherungsträgers gemeint, nicht etwa der nur abstrakte normative Schaden des Geschädigten. Die Kongruenz ist das Bindeglied zwischen dem nur normativen Schaden des Geschädigten und den erst nach dem Anspruchsübergang zu erbringenden konkreten „Sozialleistungen“ des Sozialversicherungsträgers.
Der BGH stellt zunächst zutreffend voran, dass sich das für den materiellen Schaden gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB maßgebliche Beweismaß nach § 287 Abs. 1 ZPO richtet (unverständlich daher OLG Jena, Urt. v. 15.05.2012 – 4 U 661/11 Rn. 61, OLG Hamm, Urt. v. 16.05.2023 – I-26 U 99/22 Rn. 41; OLG Stuttgart, Urt. v. 19.12.2023 – 12 U 17/23 Rn. 4, die hierfür den Vollbeweis gemäß § 286 Abs. 1 ZPO forderten). Allerdings habe das Berufungsgericht die an dieses Beweismaß zu stellenden Grundsätze verkannt.
Der BGH bejaht einen Verstoß gegen § 287 Abs. 1 ZPO und lehnt zugleich die Anwendung der subjektbezogenen Schadensbetrachtung für die Krankenkasse ab, da allein der „verletzte Versicherte“ und nicht die Krankenkasse Geschädigter sei (Rn. 11, 32). Die nach sozialversicherungsrechtlichen Grundsätzen zu erbringende Leistung der Krankenkasse sei „nicht zwingend deckungsgleich“ mit den im Sinne des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB erforderlichen Heilbehandlungsmaßnahmen. Der Sozialversicherungsträger könne den Ersatzpflichtigen nicht auf Ersatz des eigenen Schadens in Gestalt seiner durch den Versicherungsfall ausgelösten, vom Gesetzgeber angeordneten Leistungspflichten in Anspruch nehmen, er könne eine Erstattung seiner Aufwendungen nur insoweit verlangen, als sie „auf einen Schaden des Versicherten“ zu erbringen sind.
Bei Krankenhausleistungen gibt es dabei keine unterschiedlichen sozial- bzw. zivilrechtlichen Berechnungsarten. Die Pflegesätze und die Vergütung für allgemeine Krankenhausleistungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KHG, § 8 Abs. 1 Satz 1 KHEntgG, § 14 Abs. 1 Satz 1 BPflV unabhängig vom Versichertenstatus für alle Benutzer des Krankenhauses einheitlich zu berechnen und für die Parteien des Krankenhausaufnahmevertrages sowie für die Abrechnung zwischen Sozialleistungsträgern und Krankenhäusern gleichermaßen bindend. Die Krankenkasse hat die Kosten der Krankenhausbehandlung in gleicher Weise zu zahlen, wie sie auch ein selbstzahlender Patient zahlen müsste (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 15, 17; BGH, Urt. v. 27.01.1954 – VI ZR 16/53 – BGHZ 12, 154, 155 f.; BGH, Urt. v. 09.11.1989 – IX ZR 269/87; zusf. Prelinger, NZV 2024, 233, 235). Der Geschädigte bekäme daher als Selbstzahler eine inhaltsgleiche Abrechnung des Krankenhauses, § 17c Abs. 5 KHG.
Die Entscheidung des BGH vom 03.05.2011 (VI ZR 61/10) wurde vorliegend sogar vom BGH zitiert, aber deren Bedeutung verkannt. Diese Verkennung ist angesichts der Komplexität dieses Rechtsbereichs verständlich, allerdings wurde auf vorstehende Besonderheiten bereits hingewiesen (Prelinger, VersR 2022, 1337, 1339 zu 3 c). Die Ausführungen des BGH haben bereits zu Irritationen bei den Gerichten geführt, die sich jetzt fragen, was denn bei Heilbehandlungen der „eigene Schaden des Verletzten“ sei, der als gesetzlich Krankenversicherter doch gar keine Abrechnungen für die Heilbehandlung erhält und bezahlt (mit Ausnahme der Zuzahlung gemäß § 61 SGB V). Das LG Neubrandenburg hat sich davon nicht irritieren lassen und die Behandlungskosten der Krankenkasse zutreffend zuerkannt (LG Neubrandenburg, Urt. v. 20.11.2024 – 2 O 208/24).
Der konkrete Schaden gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB entsteht durch die Sachleistungen der Krankenkasse.
Die einzelnen konkreten Schadenspositionen, deren Ersatz im Rahmen des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB verlangt wird, können somit denklogisch nur bei der Krankenkasse als deren „Sozialleistungen“ entstehen und bestehen in dem Geldbetrag, den die Krankenkasse an ihre Leistungserbringer entrichten muss (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 10, 17; BGH, Urt. v. 27.01.1954 – VI ZR 16/53 – BGHZ 12, 154, 156; BGH, Urt. v. 29.06.2004 – VI ZR 211/03 Rn. 7-11; BGH, Urt. v. 10.11.1998 – VI ZR 354/97 Rn. 12). Bei Arzt- und Krankenhausbehandlungen geht dies aus § 630a Abs. 1 Halbsatz 2 BGB hervor, da die Krankenkasse „Dritter“ in diesem Sinne ist (BT-Drs. 17/10488, S. 18/19; Wagner in: MünchKomm BGB, 9. Aufl. 2023, § 630a BGB Rn. 20; Katzenmeier in: BeckOK BGB, 68. Ed. 01.11.2023, § 630a BGB Rn. 47).
Weil es sich bei den „Sozialleistungen“ um einen eigenen materiellen Schaden der Krankenkasse handelt, wurden der Krankenkasse auch die Befugnisse zur Abrechnungsprüfung gemäß den §§ 275 ff. SGB V eingeräumt.
Die zur Schadensbeseitigung erforderlichen medizinischen Behandlungen des Verletzten müssen somit durch die unfallbedingten Verletzungen verursacht worden sein. Die daraus resultierenden Kosten und damit wirtschaftlichen Schäden i.S.d. § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB entstehen aber unmittelbar allein der Krankenkasse durch ihre Zahlungen an ihre jeweiligen Leistungserbringer (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 10, 17).
c) Der BGH führt hingegen aus, dass der frühe Zeitpunkt des Anspruchsübergangs bereits nach einer „logischen Sekunde“ nichts daran ändere, dass – zutreffend – der Anspruch des Geschädigten bestehen müsse und der Sozialversicherungsträger keinen eigenen „Anspruch“ geltend machen könne. Hierbei wurde verkannt, dass das Oberlandesgericht gar nicht von einem originär eigenen „Anspruch“ der Krankenkasse ausging, sondern richtigerweise von einem übergegangenen, originär fremden Anspruch des Geschädigten, aber von einem eigenen „Schaden“ der Krankenkasse in Gestalt der nach dem Anspruchsübergang erbrachten „Sozialleistungen“ (vgl. OLG Naumburg, Urt. v. 06.07.2023 – 9 U 125/22 Rn. 43; vgl. auch Prelinger, NZV 2024, 233, Rn. 4).
Der BGH führte weiter aus, dass das OLG Naumburg die Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast der Klägerin hinsichtlich der Schadenshöhe rechtsfehlerhaft verkannt habe, den Sozialversicherungsträger träfen die gleichen Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast, wie den Geschädigten selbst, als würde er den Schadensersatzanspruch selbst geltend machen.
Weder die Regelung des § 116 SGB X noch der Gedanke, den Belangen der Sozialversicherungsträger im Regress Rechnung zu tragen, ließen eine Abweichung von diesen Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast der Klägerin bzw. deren „Besserstellung“ zu. Der Gesetzgeber habe für den Forderungsübergang nach § 116 SGB X keine „Änderung“ der Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Schadenshöhe für die hier im Streit stehenden Krankenhauskosten und Kosten einer Rehabilitationseinrichtung zugunsten von gesetzlichen Krankenkassen vorgenommen.
Diese Ausführungen gehen ebenfalls ins Leere. Hier wurde bereits das Problem verkannt. Es ging niemals darum, dass die Krankenkassen eine zivilprozessuale „Besserstellung“ verlangen oder die zivilprozessualen Darlegungs- und Beweisgrundsätze in Frage gestellt werden (vgl. Prelinger, NZV 2024, 233, 234; Prelinger, VersR 2022, 1337). Es ist vielmehr bei der Darlegung des Schadens gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB bei der Auslegung des Begriffs „erforderlich“ – wie beim Geschädigten selbst – auf die individuellen Besonderheiten der Krankenkassen Rücksicht zu nehmen, da auch diese wegen der geringen Prüfmöglichkeiten gemäß den §§ 275, 275c SGB V kaum Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten hinsichtlich der Erbringung, Erforderlichkeit und Abrechnung der Krankenhauskosten haben. Damit wird nur eine Gleichstellung mit den für den Geschädigten anerkannten Darlegungserleichterungen im Rahmen der subjektbezogenen Schadensbetrachtung erreicht.
a) Zur Begründung bezieht sich der BGH auf § 116 Abs. 8 SGB X, wonach die Krankenkasse bei nicht-stationären ärztlichen Behandlungen und bei der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln über ein Wahlrecht verfügt, diese konkret nach den Abrechnungen der Leistungserbringer oder pauschal zu berechnen. Dieses bisher nirgends angeführte Argument entstammt scheinbar dem Urteil vom 23.02.2010 (VI ZR 331/08 Rn. 13), in welchem der BGH erkannte, dass dies nur für Behandlungskosten gelte und nicht für eine abstrakte Berechnung des dort streitigen Erwerbsschadens. Vorliegend führte der BGH hierzu aus, dass es in der Gesetzesbegründung dazu heiße, dass die ärztliche Behandlung im Krankenhaus bisher schon „genau abgerechnet“ wurde. Vor diesem Hintergrund sei vorliegend weder ersichtlich, dass Sinn und Zweck des § 116 SGB X eine „Absenkung“ der Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Schadenshöhe im Streitfall gebieten würden, noch könne davon ausgegangen werden, dass eine unbeabsichtigte Regelungslücke vorliegt. Diese Ausführungen sind völlig unverständlich.
Dieses Argument passt schon historisch nicht, da die vom BGH angeführte BT-Drs. 9/1753, S. 44 f. von 1983 stammt. Das DRG-System, infolgedessen die Prüfungseinschränkungen erst zunehmend erforderlich wurden, wurde erst 2003 und somit 20 Jahre später eingeführt (zusf. Prelinger, VersR 2022, 1337, 1344 m.w.N.).
Auch wurde verkannt, dass es nur um die Auslegung des Begriffs „erforderlich“ in § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB geht.
Vor allem aber geht es vorliegend auch nicht um eine pauschale Berechnung der Krankenhauskosten. Diese werden – wie der BGH selber ausführte – „genau abgerechnet“ nach den in den Versorgungsverträgen gemäß § 109 Abs. 4 Satz 3 SGB V i.V.m. § 7 KHEntgG und § 17b KHG vereinbarten Kosten.
Mit dieser Begründung hat der BGH die Anwendung des § 116 SGB X für die Kinderheilbehandlung auf nicht rentenversicherte Familienmitglieder erstreckt (BGH, Urt. v. 19.01.2021 – VI ZR 125/20 Rn. 10). Der BGH erkannte daher auch, dass dem Geschädigten als Selbstzahler der Investitionskostenzuschlag zu ersetzen ist, da der Schädiger ansonsten ungerechtfertigt bessergestellt wäre, bekäme die Krankenkasse ihn nicht ebenso ersetzt (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 17). Auch hinsichtlich der Pflicht des Schädigers zum Ersatz der Rentenversicherungsbeiträge für die Pflegeperson erkannte der BGH, dass diese nicht dem Schädiger zugutekommen soll (BGH, Urt. v. 10.11.1998 – VI ZR 354/97 Rn. 19).
Das Schutzbedürfnis des Sozialversicherungsträgers wurde ausnahmsweise nur dort abgelehnt, wo bereits zum Zeitpunkt des Anspruchsübergangs konkrete Einwendungen und Einreden des Schädigers bestanden, denn diese waren in Hinblick auf die §§ 412, 404 BGB zu beachten (BGH, Urt. v. 24.04.2012 – VI ZR 329/10 Rn. 21; BGH, Urt. v. 04.10.1983 – VI ZR 194/81). Ausgerechnet diesen – insbesondere bei Krankenkassen seltenen – Ausnahmefall hat der BGH nun plötzlich zur Regel erhoben (Rn. 21), obwohl der BGH sogar bereits 2021 klargestellt hatte, dass es sich um eine Ausnahme für bereits vor Begründung des Sozialversicherungsverhältnisses bestehende Einwendungen und Einreden handelt (BGH, Urt. v. 19.01.2021 – VI ZR 125/20 Rn. 13; vgl. auch BGH, Urt. v. 18.10.2022 – VI ZR 1177/20).
Auch der Gesetzgeber stellte klar, dass eine unbillige Entlastung des Schädigers nicht erfolgen soll, es besteht ein grundsätzliches Interesse der Solidargemeinschaft, dass für die durch das schädigende Ereignis entstandenen Aufwände für Sozialleistungen, wie von der Grundregelung des § 116 Abs. 1 SGB X vorgesehen, verursachergerecht die schädigende Person aufkommt (Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze – Regierungsentwurf vom 13.12.2019, S. 136; vgl. Prelinger, VersR 2022, 1337, 1344). Unverständlich ist, dass der BGH auch dies übergeht.
Der BGH führt weiter aus, dass sozialrechtliche Anforderungen an das Abrechnungssystem der Krankenhäuser sowie sozialrechtliche Anforderungen an die Datenübermittlung, Prüfung von Rechnungen und Zahlungspflichten der Krankenkassen keine Abweichung von den zivilrechtlichen Grundsätzen der Darlegungs- und Beweislast nach dem Forderungsübergang gemäß § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X rechtfertigten. Die §§ 275, 275c SGB V und die §§ 284 bis 303 SGB V und das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) würden ausschließlich Rechte und Pflichten von Sozialversicherungsträgern und Leistungserbringern festlegen, aber nicht das Verhältnis zum Schädiger im Rahmen der zivilrechtlichen Haftung regeln.
Auch dies ist nicht zutreffend, es geht nicht um die Einschränkung von Rechten des Schädigers, sondern um die Rücksichtnahme auf die eingeschränkten Prüf- und Einwirkungsmöglichkeiten des schutzbedürftigen Geschädigten. Hier wird verkannt, dass der BGH diese angebliche „Grenzüberschreitung“ bzw. das „Beschneiden“ von Rechtspositionen des Schädigers selber mittels der subjektbezogenen Schadensbetrachtung zugunsten des Geschädigten in ständiger Rechtsprechung akzeptiert und daher erneut im Januar 2024 gleich mehrmals wieder bestätigte, dass der gutgläubige Geschädigte auf die Abrechnung einer Werkstatt vertrauen darf, auch wenn diese falsch war, die abgerechneten Leistungen nicht erbracht wurden oder nicht erforderlich waren (vgl. BGH, Urteile v. 16.01.2024 – VI ZR 239/22, VI ZR 253/23, VI ZR 51/23, VI ZR 38/22). Insbesondere gilt die subjektbezogene Schadensbetrachtung auch für Personenschäden (zuletzt BGH, Urt. v. 08.10.2024 – VI ZR 250/22). Diese Grundsätze stellen nur eine konkrete Auslegung des Begriffs der „Erforderlichkeit“ in § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB dar, die zu Recht auf die eingeschränkten Einwirkungs- und Prüfmöglichkeiten des Geschädigten abstellt, wie sie ebenfalls für eine Krankenkasse bei nicht prüfbaren Krankenhausabrechnungen bestehen.
Insbesondere wird die überragende Bedeutung des qualifizierten Datensatzes nach § 301 SGB V verkannt, der die für die Krankenhauskosten maßgeblichen Abrechnungsdaten enthält. § 301 Abs. 1 SGB V zählt abschließend auf, welche Angaben ein Krankenhaus der Krankenkasse übermitteln darf. Das Gesetz geht davon aus, dass die dortigen Angaben zum tatsächlichen Behandlungsgeschehen zutreffend und vollständig sind. Die Regelung gebietet nämlich, wahre Angaben zum Behandlungsgeschehen zu machen, die Fehlvorstellungen der Kassen über das konkrete abrechnungsrelevante Geschehen ausschließen (BSG, Urt. v. 19.12.2017 – B 1 KR 19/17 R). Mit der Abrechnung erfolgt die implizite Tatsachenbehauptung des Krankenhauses, es habe beim Versicherten die Befunde erhoben, die die angegebene Diagnose als rechtlich relevanten Abrechnungsbegriff rechtfertigen, und die medizinischen Behandlungen durchgeführt, die die tatbestandlichen Voraussetzungen der kodierten Operation oder Prozedur erfüllen (BSG, Urt. v. 23.05.2017 – B 1 KR 28/16 R). In dem Datensatz sind somit die für die Prüfung der Höhe des Leistungsbetrags wesentlichen Daten enthalten, die eine rechnerische Überprüfung der Krankenhausabrechnungen ermöglichen (BT-Drs. 12/3608, S. 124; BT-Drs. 14/1245, S. 106; BVerfG, Beschl. v. 26.11.2018 – 1 BvR 318/17, 1 BvR 1474/17, 1 BvR 2207/17 – NJW 2019, 351; BSG, Urt. v. 16.05.2012 – B 3 KR 14/11 R; zusf. Prelinger, NZV 2024, 233, 240 Rn. 51 m.w.N.; Prelinger, VersR 2022, 1337, 1343 m.w.N.; Prelinger, jurisPR-MedizinR 12/2019 Anm. 3 m.w.N.). Gerade weil sich die Schadenshöhe nur aus dem Rechtsverhältnis zwischen Zedenten und Zessionar ergeben kann (vgl. oben), muss auch zivilrechtlich diesen Besonderheiten Rechnung getragen werden.
Hinsichtlich des „Werkstattrisikos“ führt der BGH aus, dass die im Fall der Beschädigung einer Sache anerkannten Grundsätze auf den von einer gesetzlichen Krankenkasse geltend gemachten Ersatz der Kosten der Heilung nicht übertragbar seien. Das „Werkstattrisiko“ sei von dem Gedanken geprägt, dass es Sinn und Zweck des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB widerspreche, wenn der Geschädigte bei Ausübung der ihm durch das Gesetz eingeräumten Ersetzungsbefugnis – sei es aus materiell-rechtlichen Gründen oder aufgrund der Beweislastverteilung – im Verhältnis zu dem ersatzpflichtigen Schädiger mit Mehraufwendungen der Schadensbeseitigung belastet bliebe, deren Entstehung seinem Einfluss entzogen ist und die ihren Grund darin haben, dass die Schadensbeseitigung in einer fremden, vom Geschädigten, wohl auch nicht vom Schädiger kontrollierbaren Einflusssphäre stattfinden muss. Unter diesen Umständen bestehe kein Sachgrund, dem Schädiger das „Werkstattrisiko“ abzunehmen, das er auch zu tragen hätte, wenn der Geschädigte ihm die Beseitigung des Schadens nach § 249 Abs. 1 BGB überlassen würde. Die dem Geschädigten durch § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB gewährte Ersetzungsbefugnis sei kein Korrelat für eine Überbürdung dieses Risikos auf ihn.
Nach diesen verfänglichen Ausführungen, die für das Urteil des Berufungsgerichts sprachen, weicht der BGH aber einfach auf seine anfänglichen Ausführungen (bei Rn. 11 ff.) aus, dass die Krankenkasse nicht „Geschädigter“ sei, die sozialrechtlich zu erbringende Leistung der Krankenkasse sei nicht zwingend deckungsgleich mit den i.S.d. § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB „erforderlichen“ Heilbehandlungsmaßnahmen, auch bemesse sich der Schaden nach unterschiedlichen Grundsätzen und ohnehin trage der Zessionar das Werkstattrisiko.
§ 249 Abs. 2 Satz 1 BGB stellt Personen- und Sachschäden gleich. Die subjektbezogene Schadensbetrachtung ist daher auch bei Personenschäden anerkannt (BGH, Urt. v. 08.10.2024 – VI ZR 250/22 Rn. 10; BGH, Urt. v. 18.10.1988 – VI ZR 223/87 Rn. 17; BGH, Urt. v. 11.11.1969 – VI ZR 91/68; OLG Hamm, Urt. v. 17.10.1994 – 3 U 11/94; OLG Hamm, Urt. v. 15.03.2006 – 3 U 131/05 Rn. 30; OLG Hamm, Urt. v. 24.10.2007 – I-3 U 14/07 Rn. 70; OLG Celle, Urt. v. 30.05.2007 – 14 U 189/06 Rn. 56). Die für den Geschädigten geltenden Darlegungserleichterungen müssen daher erst recht auch bei Abrechnungen wegen Krankenhauskosten des Geschädigten gelten, wenn dieser Selbstzahler ist. Denn gemäß § 17c Abs. 5 KHG erhält der Selbstzahler – wie die Krankenkasse – die Krankenhausabrechnung nach den allgemeingültigen und daher auch für Selbstzahler zwingenden sozialgesetzlich vorgesehenen Kostenregelungen und Versorgungsverträgen, was für einen Gleichlauf von Selbstzahler und Krankenkasse spricht (vgl. BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 15, 17).
Es würde eine ungerechtfertigte Besserstellung des Schädigers darstellen, wenn es zu einer Ungleichbehandlung von Selbstzahler und Krankenkasse dadurch kommt, dass die Krankenkasse nicht diejenigen Leistungen ersetzt bekommt, die auch dem Selbstzahler zu ersetzen wären (vgl. BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 17). Der Krankenkasse ist verfassungsrechtlich die inhaltliche Prüfung der Krankenhausabrechnung aufgrund des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung grundsätzlich untersagt und nur in den ganz wenigen gemäß den §§ 275, 275c Abs. 2 SGB V im Rahmen der sog. quartalsbezogenen Prüfquoten zugelassenen Fällen von nur 5-15% gestattet (Gesetzesvorbehalt, zusf. Prelinger, NZV 2024, 233, 238 m.w.N.; Prelinger, VersR 2022, 1337, 1344; Prelinger, jurisPR-MedizinR 12/2019 Anm. 3 m.w.N.). Die Krankenkasse verfügt über keinerlei eigene Informationen und muss auf die Angaben des Krankenhauses gemäß § 301 SGB V vertrauen. Das Krankenhaus hat daher wahre Angaben zum Behandlungsgeschehen zu machen, die Fehlvorstellungen über das abrechnungsrelevante Geschehen ausschließen. Damit soll das bestehende Informationsgefälle zwischen dem rundum informierten Krankenhaus und der nur spärlich informierten Krankenkasse ausgeglichen werden (BSG, Urt. v. 18.12.2018 – B 1 KR 40/17 R m.w.N.).
Selbst wenn man also dem Urteil vom 09.07.2024 folgt und auf den Geschädigten abstellt, wäre ohnehin auf dessen Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten Rücksicht zu nehmen, als wenn ihm selbst die Rechnungen des Krankenhauses erteilt worden wären. Er kann diese inhaltlich aber überhaupt nicht prüfen und ist insoweit auch „Laie“. Hiernach ergeben sich hinsichtlich der Erbringung und Erforderlichkeit der abgerechneten medizinischen Leistungen nur die Möglichkeiten, dass entweder die Krankenkasse selber Geschädigte gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB ist – dann kommt es auf ihre nach den §§ 275 ff. SGB V begrenzten Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten bei nicht prüfbaren Krankenhausabrechnungen an – oder man stellt auf den Verletzten ab und berücksichtigt dessen noch viel begrenztere Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten als „Laie“. In beiden Fällen gelangt man zum selben Ergebnis. Der Inhalt der Krankenhausabrechnung ist ohnehin bei der Krankenkasse und dem Selbstzahler immer gleich, § 17c Abs. 5 KHG. Dass die Krankenkasse nicht schlechtergestellt werden soll als der Geschädigte, gab der BGH bereits im Urteil vom 03.05.2011 (VI ZR 61/10 Rn. 17) unmissverständlich vor. In beiden Konstellationen ist daher auf die eingeschränkten Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten Rücksicht zu nehmen. Soweit eine Rechnungsprüfung gemäß den §§ 275 ff. SGB V zulässig war, wären die Prüfergebnisse der Krankenkasse gemäß den §§ 275 ff. SGB V selbstverständlich stets zu berücksichtigen.
Vorstehendes gilt auch bei sonstigen Behandlungsrechnungen, denn auch dort kann der Geschädigte regelmäßig nicht die Erforderlichkeit und zutreffende Berechnung der Leistungen prüfen.
Der BGH führt abschließend aus, dass der Hinweis der Revisionserwiderung auf das Urt. v. 11.03.1986 (VI ZR 64/85 Rn. 8), wonach der Grundsatz gelte, dass der Schädiger sein Opfer in der Konstellation hinnehmen müsse, in der sich das Opfer befinde, in diesem Zusammenhang unbehilflich sei. Die Klägerin sei nicht Geschädigte und dieser Grundsatz sei im Zusammenhang mit gesundheitlichen Vorschäden des Geschädigten entwickelt worden.
Das ist unzutreffend, denn einerseits ist der Sozialversicherungsträger der materiell Geschädigte (vgl. oben). Andererseits verkennt der BGH, dass Vorschäden auch bei der subjektbezogenen Schadensbetrachtung gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB beachtlich sind. Denn der Schädiger hat den Geschädigten in den persönlichen und gesundheitlichen Verhältnissen zu entschädigen, in denen er ihn angetroffen hat. Daher sind die Heilbehandlungskosten des Geschädigten auch dann erforderlich, wenn sie sich durch Vorschäden erhöht haben (BGH, Urt. v. 18.10.1988 – VI ZR 223/87 Rn. 17; OLG Hamm, Urt. v. 24.10.2007 – I-3 U 14/07 Rn. 70; OLG Celle, Urt. v. 30.05.2007 – 14 U 189/06 Rn. 56; zusf. Prelinger, NZV 2024, 233, 237, Rn. 35).
Die Auswirkungen des Urteils sind angesichts der vielen Unpässlichkeiten erheblich. Die Thematik bedarf dringend der erneuten höchstrichterlichen Entscheidung.
Der Krankenkasse abzusprechen, dass sie hinsichtlich der konkreten „Sozialleistungen“ materiell Geschädigte i.S.d. § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB sei, ist unhaltbar, zumal längst das Gegenteil entschieden und vom BGH erkannt wurde (vgl. oben). Es verstößt gegen die Effektivität des Rechtschutzes gemäß Art. 103 Abs. 1 GG, wenn der Anspruchsübergang dazu dient, dem Sozialversicherungsträger den Ersatz der Kosten seiner (kausalen und kongruenten) „Sozialleistungen“ i.S.d. § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X zu ermöglichen und genau das nicht umsetzbar ist. Einen konkreten derartigen materiellen Schaden des Geschädigten gibt es nicht, die „Sozialleistungen“ der Krankenkasse müssen mittels der nötigen Kongruenz dem normativen Schaden des Geschädigten nur wertungsmäßig zurechenbar sein. Wenn beim Geschädigten dagegen ein konkreter materieller Schaden verbliebe, könnte dieser darüber verfügen, was § 116 Abs. 1 SGB X gerade verhindern soll (vgl. oben).
Die unkritische Hinnahme des Urteils im Lager der Haftpflichtversicherer klärt die aufgezeigten Probleme ohnehin nicht auf (vgl. Jahnke, jurisPR-VerkR 20/2024 Anm. 2; Figgener/Quaisser, NJW-Spezial 2024, 586; Fischer, FD-SozVR 2024, 820699; Lang/Nugel VersR 2025, 13 ff.). Vor allem aber überlagert die hiernach ergangene Entscheidung des BGH vom 08.10.2024 (VI ZR 250/22) die gesamte Thematik zugunsten der Krankenkassen. Denn wenn auf die nahezu gar nicht bestehenden Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten des Verletzten abzustellen wäre, dann müsste der Schädiger erst recht die Abrechnung ungeprüft ersetzen. Dann wären aber auch die fehlenden Prüfmöglichkeiten der Krankenkasse gemäß den §§ 275 ff. SGB V zu berücksichtigen.
Das OLG Naumburg ist gemäß § 563 Abs. 2 ZPO an die Rechtsauffassung des BGH gebunden, die Bindung erstreckt sich aber nicht auf den Sachverhalt, wenn es nach der Zurückverweisung andere Tatsachen feststellt oder seiner neuen Entscheidung aufgrund geänderter Verhältnisse einen abweichenden Sachverhalt zugrunde legt (OLG Stuttgart, Urt. v. 04.07.2016 – 5 U 186/12 Rn. 44 m.w.N.). Insbesondere wurde vom BGH nicht über die Frage entschieden, ob der Geschädigte selbst das „Krankenhausrisiko“ trägt und ob dies dann daran anknüpfend auch für die Krankenkasse gilt, was sich infolge des neuen Urteils vom 08.10.2024 (VI ZR 250/22) aufdrängt (vgl. oben). Auch dürfte eine Revision erneut geboten sein, da der BGH verkannte, dass das Oberlandesgericht nicht von einem eigenen Anspruch, sondern nur von einem eigenen materiellen Schaden der Krankenkasse ausging. Zudem wandte der BGH vorliegend § 275c SGB V in der seit 01.01.2020 geltenden Fassung an, obwohl sich der Unfall nebst Abrechnung bereits 2018 zutrug.
Dagegen, dass die Krankenkasse die konkreten Schadenspositionen mittels ihrer gemäß den §§ 284 Abs. 1 Nr. 11, 295, 299 bis 302 SGB V von den Leistungserbringern übermittelten EDV-Belege darlegen kann, hatte der BGH keine Einwendungen, zumal hierfür ohnehin das abgemilderte Beweismaß des § 287 Abs. 1 ZPO gilt.
Im Rahmen der subjektbezogenen Schadensbetrachtung sind dem Geschädigten, der auf den ärztlichen Rat vertraut und vertrauen darf, die Schäden auch dann zu ersetzen, wenn sie nicht objektiv erforderlich waren. In diesem Fall wären auch hinsichtlich der Schadenshöhe von der Krankenkasse keine weiteren Belege vorzulegen. Für die Gesundheitsschäden und Kausalitäten kann anderes gelten.
Der datenschutzrechtlich zulässige Umfang der dem Schädiger zu übersendenden Behandlungsunterlagen ist nicht geklärt. Die Übersendung der gemäß Art. 9 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. f DSGVO besonders geschützten Gesundheitsdaten ist nur bei entsprechender Erforderlichkeit zulässig, was außergerichtlich und gerichtlich zu berücksichtigen ist (präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, vgl. VG Stuttgart, Urt. v. 20.06.2024 – 14 K 870/22; VG Hamburg, Urt. v. 28.07.2022 – 21 K 1802/21). Eine pauschale Datenanforderung ist unzulässig (OLG Zweibrücken, Beschl. v. 30.05.2022 – 1 W 9/22). Die Übersendung der gesamten Patientenakte ist nicht erforderlich, es muss vielmehr stets der konkrete fallbezogene Zweck der einzelnen Beleganforderung vom Schädiger dargelegt werden. Für die Gesundheitsschäden und Kausalitäten dürften Entlassungsberichte grundsätzlich ausreichen. Die Abrechnungsdaten des Krankenhauses gemäß § 301 Abs. 1 SGB V genügen auch nach der Entscheidung vom 09.07.2024 für den Nachweis der Schadenshöhe (LG Neubrandenburg, Urt. v. 20.11.2024 – 2 O 208/24).
Datenschutzrechtlich ist es zudem unzulässig, dass nicht geeignete Personen die Gesundheitsdaten erhalten. In der Schadensregulierung bleibt regelmäßig im Unklaren, welche Personen genau aufseiten der Dienstleister von Haftpflichtversicherungen mit welcher Qualifikation die sensiblen Gesundheitsdaten prüfen und die Prüfberichte zu verantworten haben. Insbesondere hinsichtlich der oft von Dienstleistern in Frage gestellten Gesundheitsschäden, Kausalitäten und – soweit noch relevant – die medizinische Erforderlichkeit von Behandlungen ist dies problematisch, denn diese können sachkundig nur Fachärztinnen und Fachärzte der jeweils einschlägigen Fachrichtung beurteilen. Dabei können mehrere Fachrichtungen pro Schadensfall relevant sein. Daher muss die Haftpflichtversicherung dies gewährleisten. Entsprechend sind die darauf erstellten Prüfberichte vollständig und unter prüfbarer Benennung der dies verantwortenden Person und ihrer fachärztlichen Qualifikation der Krankenkasse zu übermitteln. Ansonsten sind Einwendungen unsubstanziiert und unbeachtlich. Zur Prüfung und Verteidigung von Ansprüchen sind diese Auskünfte den Haftpflichtversicherungen – trotz oftmals anderslautender Behauptung – auch stets rechtlich möglich, § 24 Abs. 1 Nr. 2 BDSG.
Im Zivilprozess spielen die Behandlungsunterlagen zunächst ohnehin keine Rolle, denn wie der BGH hier zutreffend ausführt, genügt eine Partei ihrer Darlegungslast, wenn sie Tatsachen anführt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht als entstanden erscheinen zu lassen (vgl. auch BGH, Urt. v. 18.05.2021 – VI ZR 401/19; BGH, Beschl. v. 26.03.2019 – VI ZR 163/17; BGH, Beschl. v. 27.09.2016 – VI ZR 565/15). Unsubstanziiert ist ein Vortrag daher nur bei Fehlen jeglicher Anhaltspunkte (BVerfG, Beschl. v. 24.01.2012 – 1 BvR 1819/10; BGH, Beschl. v. 11.01.2022 – VIII ZR 33/20 m.w.N.; BGH, Urt. v. 18.05.2021 – VI ZR 401/19 m.w.N.). Zudem muss sich die Klagepartei kein medizinisches Fachwissen aneignen (BGH, Beschl. v. 28.05.2019 – VI ZR 328/18 m. Anm. Prelinger, jurisPR-VersR 1/2020 Anm. 1; BGH, Beschl. v. 12.03.2019 – VI ZR 278/18; BGH, Urt. v. 19.02.2019 – VI ZR 505/17; BGH, Urt. v. 14.03.2017 – VI ZR 605/15). Der Vortrag zur Erbringung und Erforderlichkeit der abgerechneten Leistungen mittels Darstellung der öffentlich-rechtlichen EDV-Belege, welche die sozialrechtlich geregelten nötigen und aussagekräftigen Angaben der Leistungserbringer enthalten, kann per se nicht unsubstanziiert sein. Soweit außergerichtlich nicht die erforderlichen Belege vorgelegt wurden, kann sich das allenfalls gemäß den §§ 119 Abs. 3, 120 VVG, § 286 Abs. 4 BGB auf die Zinsen und Kosten auswirken (OLG Stuttgart, Urt. v. 25.07.2024 – 2 U 26/23; OLG Stuttgart, Urt. v. 30.07.2024 – 12 U 130/23).
Die Entscheidung des BGH ist auch hinsichtlich etwaiger anschließender Rechtsstreitigkeiten problematisch. Denkbar ist, dass die Krankenkasse gegenüber dem Krankenhaus nunmehr zivilrechtliche Bereicherungsansprüche aus den §§ 812 ff. BGB geltend macht, wenn sich herausstellt, dass Behandlungen sozialrechtlich falsch abgerechnet wurden. Im Klageverfahren müsste gemäß den §§ 72 ff. ZPO der Streit verkündet werden. Hier besteht das Problem, ob die §§ 275 ff. SGB V eine Sperrwirkung entfalten bzw. bei nicht prüfbarer Abrechnung einen Rechtsgrund für die Zahlung bilden. Problematisch ist auch der Rechtsweg, da auch die Sozialgerichte zuständig und damit eine zivilprozessuale Streitverkündung wirkungslos sein könnte.
Der BGH führt zur Untermauerung seiner Auffassung, dass die sozialrechtlichen Systemanforderungen keine Abweichung von der zivilrechtlichen Darlegungs- und Beweislast nach sich ziehen, die Regelung des § 294a SGB V an. Dieser verpflichte unter anderem Krankenhäuser gemäß § 108 SGB V, „die erforderlichen Daten“, einschließlich der Angaben über Ursachen und mögliche Verursacher, den Krankenkassen mitzuteilen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Krankheit die Folge eines Unfalls ist. Der Gesetzgeber habe mit § 294a SGB V eine Norm geschaffen, mit der Krankenkassen Angaben zur Verfügung gestellt werden sollen, die sie benötigen, um nach § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X auf sie übergegangene Schadensersatzansprüche geltend machen zu können.
Diese Ausführungen sind unverständlich, denn § 294a SGB V sagt nichts über die zivilrechtliche Darlegungs- und Beweislast aus. Die Regelung setzt zudem voraus, dass die Krankenkassen diese Daten auch erhalten. Aus der Praxis ist hingegen bekannt, dass Ärzte und Krankenhäuser fast nie dieser Verpflichtung nachkommen und die Norm daher weitgehend gegenstandslos ist.
§ 294a SGB V regelt auch nur die Mitteilungspflicht der Leistungserbringer, da § 294a SGB V systematisch bei den Pflichten der Leistungserbringer eingeordnet wurde und diese von ihrer Schweige- und Datenschutzpflicht befreien sollte. Aus einer einseitigen Pflicht eines Leistungserbringers wird öffentlich-rechtlich keine Rechtsgrundlage zur aktiven Anforderung von Belegen. Ein Anfordern würde bereits eine Datenerhebung darstellen, für die es einer verfassungsgemäßen Rechtsgrundlage bedarf, die dem Grundsatz der Normenklarheit und Verhältnismäßigkeit entspricht. Bei § 294a SGB V ist diese Befugnis unklar (vgl. LSG Celle-Bremen, Urt. v. 11.11.2009 – L 1 KR 152/08; AG Magdeburg, Urt. v. 19.11.2008 – 180 C 2825/07; SG Berlin, Urt. v. 01.06.2004 – S 82 KR 2038/02; SG Potsdam, Beschl. v. 27.03.2008 – S 1 KA 191/06, zusf. Prelinger, VersR 2022, 1337, 1341; Prelinger, NZV 2024, 233, 242, Rn. 66).
Autor
Wolfdietrich Prelinger, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht, Fachanwalt für Versicherungsrecht
Erscheinungsdatum
7. März 2025
Anmerkung zu BGH, Urteil vom 9. Juli 2024 - VI ZR 252/23
Quelle
Fundstelle
LMK Leitsatz mit Kommentierung 2025, Heft 2
Zitiervorschlag
Prelinger, LMK 2025, 801434
Mit Übersendung der Krankenhausabrechnung an die Krankenkasse gemäß § 301 SGB V wird die Regressforderung fällig. Das Gericht hat Beweis zu erheben, wenn die Verletzungen und die Kostenbelege aus der EDV der Krankenkasse vorgetragen wurden - Oberlandesgericht Rostock, Urteil vom 07.02.2025, Az. 5 U 69/22, juris
Tenor
1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 10.403,63 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 03.08.2022 sowie vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 878,22 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 15.05.2024 zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche weiteren Schäden zu 100 Prozent zu ersetzen, welche der Klägerin aus dem Schadensereignis der … vom 25.01.2022 gegen 16.10 Uhr auf der …, entstanden sind und noch entstehen werden.
3. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Beschluss: Der Streitwert wird auf 13.403,63 € festgesetzt.
Tatbestand
Die Klägerin macht gegen den Beklagten einen Regressanspruch aus übergegangenem Recht gemäß § 116 SGB X geltend.
Die Klägerin ist Krankenversicherer der bei einem Verkehrsunfall am 25.01.2022 verletzten Geschädigten … . Der Beklagte ist Haftpflichtversicherer des unfallverursachenden Fahrzeugs.
Die Geschädigte war angeschnallte Beifahrerin im Fahrzeug des Versicherungsnehmers des Beklagten. Dieser musste einem unbekannt gebliebenen entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und kollidierte mit einem Baum. Die Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst mit Notarzteinsatz in das …-Klinikum Neubrandenburg gebracht. Sie erlitt eine Bauchdeckenprellung, eine Thoraxprellung, eine Halsprellung sowie eine traumatische Perforation des Dünndarms, die operativ versorgt werden musste und einen stationären Aufenthalt in der Zeit vom 25.01. bis zum 02.02.2022 erforderlich machte. Die Klägerin erbrachte Leistungen in Höhe von 850,00 € für den Rettungseinsatz, 770,00 € für den Notarzteinsatz und 8.629,13 € für die stationäre Behandlung der Geschädigten im … Klinikum Neubrandenburg. Mit Schreiben vom 16.06.2022 forderte die Klägerin den Beklagten außergerichtlich zur Regulierung auf. Der Beklagte verlangte daraufhin die Vorlage vollständiger Behandlungsunterlagen.
Die Klägerin vertritt die Auffassung, mit den als Anlage K1 vorgelegten Abrechnungsunterlagen, aus denen sich vollständige Diagnosen und eine Auflistung aller medizinischen Eingriffe ergäben, habe sie ihrer Darlegungslast in vollem Umfang Genüge getan. Weitere Abrechnungsunterlagen lägen ihr nicht vor. Die vorgelegten Unterlagen erfüllten die Anforderungen aus§ 301 SGB V.
Die Klägerin beantragt,
1. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 10.403,63 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz per annum seit dem 03.08.2022 zu zahlen,
2. festzustellen, dass die Beklagte darüber hinaus der Klägerin sämtliche weiteren Schäden mit einer Haftungsquote von 100 % zu ersetzen hat, die der Klägerin aus dem Schadensereignis der … vom 25.01.2022 gegen 16:10 Uhr auf der … entstanden sind und noch entstehen werden.
3. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin 878,22 € vorgerichtliche Anwaltskosten ihres jetzigen Prozessbevollmächtigten nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen.
Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.
Der Beklagte stellt seine grundsätzliche Einstandspflicht für die Unfallfolgen unstreitig, moniert allerdings, dass die Klägerin keine prüfbare Abrechnung vorgelegt habe. Dies sei notwendig, um insbesondere die Erforderlichkeit der Behandlung und die Kausalität des Behandlungsaufwandes mit dem Unfallereignis prüfen zu können. Der Beklagte weist darauf hin, dass ihm keine eigenen Behandlungsunterlagen der Geschädigten vorlägen, da diese keinen Direktanspruch gegen ihn geltend gemacht habe.
Zur weiteren Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen allen Parteien gewechselten Schriftsätze und auf das Verhandlungsprotokoll Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die Klage ist zulässig und begründet.
1. Die Klägerin hat gegen den Beklagten aus übergegangenem Recht der bei ihr versicherten Geschädigten gemäß § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X dem Grunde nach einen Anspruch auf Schadensersatz in Form des Ersatzes der Kosten der Heilung wegen der bei dem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen aus §§ 7 Abs. 1, 11 Satz 1 StVG, § 115 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VVG i. V. m. § 1 Satz 1 PflVG. Gegenstand des nach § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X auf die Klägerin übergegangenen Schadensersatzanspruches ist der Schaden des Versicherten, hier also der Frau … . Der Anspruchsübergang findet im Zeitpunkt des schadensstiftenden Ereignisses statt. Die Forderung des Geschädigten gegen den Schadensersatzpflichtigen geht im Wege der Legalzession des § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X unverändert, d. h. genauso, wie sie dem Geschädigten zustand, auf den Sozialversicherungsträger über (BGH, Urteil vom 07.12.2021, VI ZR 1189/20, zitiert nach juris Rn. 19).
Die Bemessung der Höhe des Schadensersatzanspruches liegt gemäß § 287 ZPO im Ermessen des Gerichts (BGH, Urteil vom 09.07.2024, VI ZR 252/23, zitiert nach juris Rn. 10). Ausgehend von dem Grundgedanken, dass die Rechtsposition des Schuldners durch einen Forderungsübergang nicht verschlechtert werden darf und dem Grundsatz, dass der Anspruchsteller die anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen und zu beweisen hat, treffen den Sozialversicherungsträger, der den auf ihn übergegangenen Schadensersatzanspruch geltend macht, im Grundsatz die gleichen Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast wie den Geschädigten, würde er den Schadensersatzanspruch selbst geltend machen (BGH, a.a.O., Rn. 17 m.w.N.).
Die Klägerin hat hier mit dem Anlagenkonvolut K1 Nachweise über die für den Notfalleinsatz entstandenen Kosten für Notarzt und Rettungseinsatz sowie für die nachfolgende medizinische Behandlung der Geschädigten im Dietrich Bonhoeffer Klinikum in Neubrandenburg vorgelegt. Entgegen der Auffassung der Beklagten reichen diese Nachweise zur Begründung des Anspruches aus. Es handelt sich hierbei um die der Krankenkasse vorliegenden EDV-Belege über die Behandlungskosten. Die Klägerin ist als gesetzliche Krankenkasse ein Hoheitsträger im Sinne des § 4 Abs. 1 SGB V. Ihre Datenerhebungsbefugnisse richten sich nach den Vorschriften der §§ 294 - 303 SGB V. Aus § 301 SGB V ergibt sich, dass die von den Krankenkassen verpflichteten Leistungserbringer die maßgeblichen Abrechnungsdaten an die Krankenkasse maschinenlesbar bzw. im Wege elektronischer Datenübertragung zu übermitteln haben. Weitere Kostenbelege existieren aufgrund des ausschließlich elektronischen Übermittlungssystems und ansonsten fehlender Rechtsgrundlage für die Übermittlung höchstpersönlicher Daten nicht. Die Klägerin hat der Beklagten mit dem Anlagenkonvolut K1 den gemäß § 301 SGB V gesetzlich vorgeschriebenen Ausdruck der Daten übermittelt. Dieser Datensatz enthält alle Informationen, welche die Beklagte benötigt, um die Richtigkeit der gegen sie geltend gemachten Ansprüche überprüfen zu können. Insbesondere ergeben sich daraus die persönlichen Daten der Geschädigten, alle erhobenen Diagnosen sowie die durchgeführten medizinischen Maßnahmen.
Aus der bereits zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs ergibt sich vorliegend nichts anderes. Richtig ist zwar, dass der BGH in dieser Entscheidung mitteilt, dass die von den Behandlungseinrichtungen erstellten Abrechnungsdaten nach allgemeinen Grundsätzen nur einen Anhaltspunkt, aber kein wesentliches bzw. starkes Indiz für die Erbringung und/oder die Erforderlichkeit der abgerechneten Leistung darstellen (BGH, a.a.O., Rn. 28). Allerdings hat der BGH das Verfahren zur neuen Entscheidung an das Ausgangsgericht zurückverwiesen. Der wesentliche Unterschied zu dem vorliegenden Fall liegt darin, dass die Beklagtenseite in dem vom BGH zu entscheidenden Sachverhalt Einwendungen gegen die Abrechnungspositionen vorgebracht hat. Der wesentliche Kritikpunkt des BGH an der Vorentscheidung lag darin, dass das Vordergericht nicht den gesamten Parteivortrag gewürdigt habe, sich ausschließlich auf die vorgelegten Abrechnungsunterlagen gestützt habe und sich mit den in beiden Instanzen erhobenen Einwendungen der Beklagtenseite nicht auseinandergesetzt habe (BGH, a.a.O., Rn. 35). Die Anforderungen, die an die Darlegungslast einer Partei zu stellen sind, hängen maßgeblich davon ab, wie die Gegenseite sich hierzu positioniert. Im vorliegenden Fall sind keinerlei Einwendungen gegen die Abrechnung erhoben worden, sondern die Beklagte hat sich allein auf das formelle Argument der fehlenden Prüfbarkeit zurückgezogen. Der Vortrag der Klägerseite ist nicht bestritten worden. Es sind nicht einmal Tatsachen vorgetragen worden, die einen Zweifel an der Plausibilität der vorgetragenen von der Geschädigten erlittenen Verletzungsfolgen und der von der Klägerin gegenüber ihrer Versicherungsnehmerin erbrachten Leistungen begründen könnten. Die notwendigen Informationen zur Prüfung des Anspruches lagen der Beklagten vor. Eine Beweiserhebung, die möglicherweise die Vorlage weiterer Behandlungsunterlagen erforderlich gemacht hätte, ist hier nicht notwendig, da der Anspruch nicht bestritten wurde.
2. Der Feststellungsantrag ist zulässig und begründet. Das gemäß § 256 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist hier gegeben, da jedenfalls die Möglichkeit eines weiteren Schadenseintritts besteht (BGH, Urteil vom 09.01.2007, VI ZR 133/06, zitiert nach juris Rn. 5). Der Feststellungsantrag ist auch begründet, da der Schadensersatzanspruch dem Grunde nach gegeben ist, der künftige Schäden aufgrund des jugendlichen Alters der Geschädigten und der Schwere der erlittenen inneren Verletzungen jedenfalls möglich erscheinen lässt. Der Schadenseintritt muss nicht wahrscheinlich sein (BGH, Urteil vom 17.10.2017, VI ZR 423/16, zitiert nach juris Rn. 49).
3. Der Zinsanspruch und der Anspruch auf außergerichtliche Rechtsanwaltskosten sind aus dem Gesichtspunkt des Verzuges gerechtfertigt. Nachdem die Klägerin mit Schreiben vom 16.06.2022 ihre Ansprüche außergerichtlich geltend gemacht und die Beklagte dieses Ansinnen zurückgewiesen hatte, hat die Klägerin mit Schreiben vom 02.08.2022 gemahnt. Mit Zugang der Mahnung ist Verzug eingetreten.
4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO; der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat seine Rechtsgrundlage in § 709 Satz 1 ZPO.
Der Datensatz nach § 301 SGB V enthält grundsätzlich alle notwendigen Daten zum Nachweis der Krankenhauskosten - LG Neubrandenburg, Urteil vom 20.11.2024 – 2 O 208/24 –, juris
Tenor
1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 10.403,63 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 03.08.2022 sowie vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 878,22 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 15.05.2024 zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche weiteren Schäden zu 100 Prozent zu ersetzen, welche der Klägerin aus dem Schadensereignis der … vom 25.01.2022 gegen 16.10 Uhr auf der …, entstanden sind und noch entstehen werden.
3. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Beschluss: Der Streitwert wird auf 13.403,63 € festgesetzt.
Tatbestand
Die Klägerin macht gegen den Beklagten einen Regressanspruch aus übergegangenem Recht gemäß § 116 SGB X geltend.
Die Klägerin ist Krankenversicherer der bei einem Verkehrsunfall am 25.01.2022 verletzten Geschädigten … . Der Beklagte ist Haftpflichtversicherer des unfallverursachenden Fahrzeugs.
Die Geschädigte war angeschnallte Beifahrerin im Fahrzeug des Versicherungsnehmers des Beklagten. Dieser musste einem unbekannt gebliebenen entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und kollidierte mit einem Baum. Die Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst mit Notarzteinsatz in das …-Klinikum Neubrandenburg gebracht. Sie erlitt eine Bauchdeckenprellung, eine Thoraxprellung, eine Halsprellung sowie eine traumatische Perforation des Dünndarms, die operativ versorgt werden musste und einen stationären Aufenthalt in der Zeit vom 25.01. bis zum 02.02.2022 erforderlich machte. Die Klägerin erbrachte Leistungen in Höhe von 850,00 € für den Rettungseinsatz, 770,00 € für den Notarzteinsatz und 8.629,13 € für die stationäre Behandlung der Geschädigten im … Klinikum Neubrandenburg. Mit Schreiben vom 16.06.2022 forderte die Klägerin den Beklagten außergerichtlich zur Regulierung auf. Der Beklagte verlangte daraufhin die Vorlage vollständiger Behandlungsunterlagen.
Die Klägerin vertritt die Auffassung, mit den als Anlage K1 vorgelegten Abrechnungsunterlagen, aus denen sich vollständige Diagnosen und eine Auflistung aller medizinischen Eingriffe ergäben, habe sie ihrer Darlegungslast in vollem Umfang Genüge getan. Weitere Abrechnungsunterlagen lägen ihr nicht vor. Die vorgelegten Unterlagen erfüllten die Anforderungen aus§ 301 SGB V.
Die Klägerin beantragt,
1. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 10.403,63 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz per annum seit dem 03.08.2022 zu zahlen,
2. festzustellen, dass die Beklagte darüber hinaus der Klägerin sämtliche weiteren Schäden mit einer Haftungsquote von 100 % zu ersetzen hat, die der Klägerin aus dem Schadensereignis der … vom 25.01.2022 gegen 16:10 Uhr auf der … entstanden sind und noch entstehen werden.
3. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin 878,22 € vorgerichtliche Anwaltskosten ihres jetzigen Prozessbevollmächtigten nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen.
Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.
Der Beklagte stellt seine grundsätzliche Einstandspflicht für die Unfallfolgen unstreitig, moniert allerdings, dass die Klägerin keine prüfbare Abrechnung vorgelegt habe. Dies sei notwendig, um insbesondere die Erforderlichkeit der Behandlung und die Kausalität des Behandlungsaufwandes mit dem Unfallereignis prüfen zu können. Der Beklagte weist darauf hin, dass ihm keine eigenen Behandlungsunterlagen der Geschädigten vorlägen, da diese keinen Direktanspruch gegen ihn geltend gemacht habe.
Zur weiteren Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen allen Parteien gewechselten Schriftsätze und auf das Verhandlungsprotokoll Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die Klage ist zulässig und begründet.
1. Die Klägerin hat gegen den Beklagten aus übergegangenem Recht der bei ihr versicherten Geschädigten gemäß § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X dem Grunde nach einen Anspruch auf Schadensersatz in Form des Ersatzes der Kosten der Heilung wegen der bei dem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen aus §§ 7 Abs. 1, 11 Satz 1 StVG, § 115 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VVG i. V. m. § 1 Satz 1 PflVG. Gegenstand des nach § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X auf die Klägerin übergegangenen Schadensersatzanspruches ist der Schaden des Versicherten, hier also der Frau … . Der Anspruchsübergang findet im Zeitpunkt des schadensstiftenden Ereignisses statt. Die Forderung des Geschädigten gegen den Schadensersatzpflichtigen geht im Wege der Legalzession des § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X unverändert, d. h. genauso, wie sie dem Geschädigten zustand, auf den Sozialversicherungsträger über (BGH, Urteil vom 07.12.2021, VI ZR 1189/20, zitiert nach juris Rn. 19).
Die Bemessung der Höhe des Schadensersatzanspruches liegt gemäß § 287 ZPO im Ermessen des Gerichts (BGH, Urteil vom 09.07.2024, VI ZR 252/23, zitiert nach juris Rn. 10). Ausgehend von dem Grundgedanken, dass die Rechtsposition des Schuldners durch einen Forderungsübergang nicht verschlechtert werden darf und dem Grundsatz, dass der Anspruchsteller die anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen und zu beweisen hat, treffen den Sozialversicherungsträger, der den auf ihn übergegangenen Schadensersatzanspruch geltend macht, im Grundsatz die gleichen Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast wie den Geschädigten, würde er den Schadensersatzanspruch selbst geltend machen (BGH, a.a.O., Rn. 17 m.w.N.).
Die Klägerin hat hier mit dem Anlagenkonvolut K1 Nachweise über die für den Notfalleinsatz entstandenen Kosten für Notarzt und Rettungseinsatz sowie für die nachfolgende medizinische Behandlung der Geschädigten im Dietrich Bonhoeffer Klinikum in Neubrandenburg vorgelegt. Entgegen der Auffassung der Beklagten reichen diese Nachweise zur Begründung des Anspruches aus. Es handelt sich hierbei um die der Krankenkasse vorliegenden EDV-Belege über die Behandlungskosten. Die Klägerin ist als gesetzliche Krankenkasse ein Hoheitsträger im Sinne des § 4 Abs. 1 SGB V. Ihre Datenerhebungsbefugnisse richten sich nach den Vorschriften der §§ 294 - 303 SGB V. Aus § 301 SGB V ergibt sich, dass die von den Krankenkassen verpflichteten Leistungserbringer die maßgeblichen Abrechnungsdaten an die Krankenkasse maschinenlesbar bzw. im Wege elektronischer Datenübertragung zu übermitteln haben. Weitere Kostenbelege existieren aufgrund des ausschließlich elektronischen Übermittlungssystems und ansonsten fehlender Rechtsgrundlage für die Übermittlung höchstpersönlicher Daten nicht. Die Klägerin hat der Beklagten mit dem Anlagenkonvolut K1 den gemäß § 301 SGB V gesetzlich vorgeschriebenen Ausdruck der Daten übermittelt. Dieser Datensatz enthält alle Informationen, welche die Beklagte benötigt, um die Richtigkeit der gegen sie geltend gemachten Ansprüche überprüfen zu können. Insbesondere ergeben sich daraus die persönlichen Daten der Geschädigten, alle erhobenen Diagnosen sowie die durchgeführten medizinischen Maßnahmen.
Aus der bereits zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs ergibt sich vorliegend nichts anderes. Richtig ist zwar, dass der BGH in dieser Entscheidung mitteilt, dass die von den Behandlungseinrichtungen erstellten Abrechnungsdaten nach allgemeinen Grundsätzen nur einen Anhaltspunkt, aber kein wesentliches bzw. starkes Indiz für die Erbringung und/oder die Erforderlichkeit der abgerechneten Leistung darstellen (BGH, a.a.O., Rn. 28). Allerdings hat der BGH das Verfahren zur neuen Entscheidung an das Ausgangsgericht zurückverwiesen. Der wesentliche Unterschied zu dem vorliegenden Fall liegt darin, dass die Beklagtenseite in dem vom BGH zu entscheidenden Sachverhalt Einwendungen gegen die Abrechnungspositionen vorgebracht hat. Der wesentliche Kritikpunkt des BGH an der Vorentscheidung lag darin, dass das Vordergericht nicht den gesamten Parteivortrag gewürdigt habe, sich ausschließlich auf die vorgelegten Abrechnungsunterlagen gestützt habe und sich mit den in beiden Instanzen erhobenen Einwendungen der Beklagtenseite nicht auseinandergesetzt habe (BGH, a.a.O., Rn. 35). Die Anforderungen, die an die Darlegungslast einer Partei zu stellen sind, hängen maßgeblich davon ab, wie die Gegenseite sich hierzu positioniert. Im vorliegenden Fall sind keinerlei Einwendungen gegen die Abrechnung erhoben worden, sondern die Beklagte hat sich allein auf das formelle Argument der fehlenden Prüfbarkeit zurückgezogen. Der Vortrag der Klägerseite ist nicht bestritten worden. Es sind nicht einmal Tatsachen vorgetragen worden, die einen Zweifel an der Plausibilität der vorgetragenen von der Geschädigten erlittenen Verletzungsfolgen und der von der Klägerin gegenüber ihrer Versicherungsnehmerin erbrachten Leistungen begründen könnten. Die notwendigen Informationen zur Prüfung des Anspruches lagen der Beklagten vor. Eine Beweiserhebung, die möglicherweise die Vorlage weiterer Behandlungsunterlagen erforderlich gemacht hätte, ist hier nicht notwendig, da der Anspruch nicht bestritten wurde.
2. Der Feststellungsantrag ist zulässig und begründet. Das gemäß § 256 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist hier gegeben, da jedenfalls die Möglichkeit eines weiteren Schadenseintritts besteht (BGH, Urteil vom 09.01.2007, VI ZR 133/06, zitiert nach juris Rn. 5). Der Feststellungsantrag ist auch begründet, da der Schadensersatzanspruch dem Grunde nach gegeben ist, der künftige Schäden aufgrund des jugendlichen Alters der Geschädigten und der Schwere der erlittenen inneren Verletzungen jedenfalls möglich erscheinen lässt. Der Schadenseintritt muss nicht wahrscheinlich sein (BGH, Urteil vom 17.10.2017, VI ZR 423/16, zitiert nach juris Rn. 49).
3. Der Zinsanspruch und der Anspruch auf außergerichtliche Rechtsanwaltskosten sind aus dem Gesichtspunkt des Verzuges gerechtfertigt. Nachdem die Klägerin mit Schreiben vom 16.06.2022 ihre Ansprüche außergerichtlich geltend gemacht und die Beklagte dieses Ansinnen zurückgewiesen hatte, hat die Klägerin mit Schreiben vom 02.08.2022 gemahnt. Mit Zugang der Mahnung ist Verzug eingetreten.
4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO; der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat seine Rechtsgrundlage in § 709 Satz 1 ZPO.
Subjektbezogene Schadensbetrachtung im Regress des Sozialversicherungsträgers - Prelinger, jurisPR-MedizinR 12/2024 Anm. 1 (Besprechung des Urteils des BGH vom 9. Juli 2024 - VI ZR 252/23)
Im Regress der gesetzlichen Krankenkasse gemäß § 116 SGB X ist hinsichtlich der Krankenhauskosten umstritten, ob auch die gesetzliche Krankenkasse die für den Geschädigten geltenden Darlegungserleichterungen der „subjektbezogenen Schadensbetrachtung“ bei der Auslegung des Begriffs „erforderlich“ in § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB in Anspruch nehmen kann.
Im Rahmen der subjektbezogenen Schadensbetrachtung ist Rücksicht auf die spezielle Situation des Geschädigten, insbesondere auf seine Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie auf die gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten zu nehmen (BGH, Urt. v. 16.01.2024 – VI ZR 51/23 sowie BGH, Urt. v. 16.01.2024 – VI ZR 38/22). Der BGH erkannte nunmehr, dass dies auch für Personenschäden gilt (Urt. v. 08.10.2024 – VI ZR 250/22).
Für die Krankenkasse, die gemäß § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X nur den übergegangenen Anspruch des Geschädigten regressieren und daher nicht schlechtergestellt werden darf als dieser (vgl. BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10), drängt sich daher die Anwendung dieser Grundsätze in Regressen auf, bei denen ihnen die Prüfung der Krankenhausabrechnung gesetzlich untersagt ist. Denn aufgrund der horrenden Menge von ca. 18 Mio. Krankenhausabrechnungen pro Jahr dürfen die Krankenhausabrechnungen von den Krankenkassen nur äußerst eingeschränkt geprüft werden, insbesondere nur innerhalb der sog. quartalsbezogenen Prüfquoten von 5-15%, §§ 275, 275c Abs. 2 SGB V. Wegen des sich aus dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ergebenden Gesetzesvorbehalts dürfen Krankenkassen Gesundheitsdaten nur dann verwenden, wenn ihnen dieses ausdrücklich vom Gesetzgeber gestattet wurde. Daher können auch die Krankenkassen bei nicht prüfbaren Abrechnungen nicht mehr tun, als die Rechnung ungeprüft dem Schädiger in Rechnung zu stellen – wie es auch der Geschädigte als „Laie“ täte (vgl. Prelinger, jurisPR-MedizinR 12/2019 Anm. 3; Prelinger, VersR 2022, 1337, 1344; Prelinger, NZV 2024, 233, 236, Rn. 20 ff.). Das Berufungsgericht teilte diese Auffassung (OLG Naumburg, Urt. v. 06.07.2023 – 9 U 125/22).
Der BGH hat in der hier besprochenen Entscheidung jedoch die Anwendung der subjektbezogenen Schadensbetrachtung mit der Begründung verneint, dass der Geschädigte nur der „Verletzte“ sei. Zudem wurde unzutreffenderweise unterstellt, dass Krankenkassen eine Privilegierung erstrebten, obwohl sie nur die Gleichbehandlung mit dem Geschädigten fordern, der sich aber selbst auch auf die subjektbezogene Schadensbetrachtung berufen kann. Die Entscheidung ist auch in weiteren wesentlichen Punkten unzutreffend und daher insgesamt nicht haltbar. Scheinbar ist der BGH den Stimmen aus dem Lager der Haftpflichtversicherer etwas zu unkritisch gefolgt (vgl. Lang, RuS 2023, 930; Burmann/Jahnke, RuS 2023, 145; Seiler, VersR 2024, 188, 195; Burmann/Jahnke, RuS 2024, 184; Bähring/Liborius, NJW-Spezial 2024, 73; Möhlenkamp, VersR 2024, 209; Drewes, NZV 2024, 136; Bähring/Burmann/Jahnke/Liborius, NZV 2024, 158). Für die Haftpflichtversicherer ist die subjektbezogene Schadensbetrachtung ungünstig, da damit ggf. auch weitergehende Leistungen ersetzt werden müssen, die objektiv nicht erforderlich waren.
Die klagende gesetzliche Krankenkasse verlangt vom beklagten Haftpflichtversicherer aus gemäß § 116 Abs. 1 SGB X übergegangenem Recht Erstattung ihrer Kosten, die sie für die Krankenhausbehandlung ihres versicherten Mitgliedes bzw. Geschädigten aufzuwenden hatte.
Der Geschädigte wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die volle Haftung der Beklagten dem Grunde nach sowie die Schwere der Verletzungen des Versicherten, die eine stationäre ärztliche Behandlung notwendig machten, stehen außer Streit. Der geschädigte Versicherte befand sich nach dem Unfall zunächst in einem Universitätsklinikum und anschließend in einem Rehabilitationszentrum. Für die Behandlung im Universitätsklinikum bezahlte die Klägerin 57.524,84 Euro, für die Behandlung im Rehabilitationszentrum 35.846,51 Euro. Von den für die Behandlung im Universitätsklinikum geforderten Kosten hat die Beklagte einen Betrag von 48.664,74 Euro anerkannt. Eine weitere Zahlung wurde mangels prüffähiger Unterlagen abgelehnt. Die Klägerin meinte dagegen, die der Beklagten übersandten Abrechnungsdaten des Krankenhauses sowie die Krankenhausberichte seien zur Darlegung der Schadenshöhe ausreichend.
Das Landgericht gab der auf Zahlung des restlichen Betrags von 44.706,61 Euro sowie auf Zahlung von Zinsen und vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten gerichteten Klage statt. Das OLG Naumburg wies die Berufung der Beklagten mit Urt. v. 06.07.2023 (9 U 125/22) zurück.
Der BGH hat auf die Revision der Beklagten die Entscheidung des Oberlandesgerichts aufgehoben und wegen der noch offenen Beweisfragen die Sache zurückverwiesen.
Das angefochtene Urteil halte revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand. Mit der Begründung des Berufungsgerichts könne die noch streitige Klageforderung als Schadensersatzanspruch der Höhe nach nicht zuerkannt werden.
Um die Problematik verständlicher zu machen, sind die Besonderheiten der Gesetzeskonstruktion voranzustellen: Krankenkassen sind im Wege der sozialstaatlichen Daseinsvorsorge verpflichtet, vorab Verträge mit medizinischen und sonstigen Leistungserbringern abzuschließen, welche die durchgehende Versorgung der Versicherten bei Erkrankungen und Verletzungen sicherstellen und auch privatrechtsgestaltende Wirkung haben (BGH, Urt. v. 29.06.2004 – VI ZR 211/03; OLG Hamm, Urt. v. 23.06.2009 – 9 U 150/08; BSG, Urt. v. 03.11.1999 – B 3 KR 4/99 R – BSGE 85, 110, 112).
Kommt es zu einem Schadensereignis eines Versicherten (= Verletzten), aus dem diesem ein Schadensersatzanspruch gegen Dritte entsteht, so regelt § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X, dass ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz eines Schadens auf den Sozialversicherungsträger übergeht, soweit dieser aufgrund des Schadensereignisses „Sozialleistungen“ zu erbringen hat, die der Behebung eines Schadens der gleichen Art dienen und sich auf denselben Zeitraum wie der vom Schädiger zu leistende Schadensersatz beziehen. Der Anspruch des Geschädigten (= Verletzten) geht vorab bereits dem Grunde nach sofort im Zeitpunkt des Schadensfalls binnen einer logischen Sekunde auf die Krankenkasse über und umfasst alle künftigen Sozialleistungen, die sachlich und zeitlich mit den Schadensersatzansprüchen des Geschädigten kongruent sind. Dabei reicht selbst eine weit entfernte Möglichkeit des Eintritts solcher Tatsachen aus, aufgrund derer Versicherungsleistungen zu erbringen sein werden, soweit die Entstehung solcher Leistungspflichten nicht völlig unwahrscheinlich ist (BGH, Urt. v. 12.04.2011 – VI ZR 158/10 Rn. 8; BGH, Urt. v. 24.04.2012 – VI ZR 329/10; BGH, Urt. v. 12.04.2011 – VI ZR 158/10; BGH, Urt. v. 20.09.1994 – VI ZR 285/93). Dies umfasst sogar auch solche künftigen Sozialleistungen, deren inhaltliche Ausgestaltung durch Veränderungen im Leistungsgefüge erst später erfolgt, soweit eine als Grundlage für den Forderungsübergang geeignete Leistungspflicht des Sozialversicherungsträgers gegenüber dem Geschädigten überhaupt in Betracht kommt (BGH, Urt. v. 12.04.2011 – VI ZR 158/10 Rn. 8 m.w.N.). Der sofortige Anspruchsübergang dem Grunde nach dient damit dem Ausgleich der vom Sozialversicherungsträger künftig zu erbringenden Sozialleistungen (BGH, Urt. v. 17.10.2017 – VI ZR 423/16 Rn. 29).
Der sofortige Übergang dient auch dem Schutz der Versichertengemeinschaft, die vor nachteiligen Verfügungen des Geschädigten geschützt werden soll (BGH, Urt. v. 19.01.2021 – VI ZR 125/20; BGH, Urt. v. 17.10.2017 – VI ZR 423/16; BGH, Urt. v. 24.04.2012 – VI ZR 329/10). Ein Übergang der Höhe nach kann somit nicht erfolgen, dem Verletzten können binnen der logischen Sekunde noch keine konkreten Kosten (Schadenspositionen) entstanden sein. Der Anspruch des Geschädigten wird vorab sofort dem Grunde nach zum erst künftig der Höhe nach beim Sozialversicherungsträger entstehenden Schaden in Form der von diesem dem Geschädigten zu leistenden „Sozialleistungen“ gezogen, was zugleich eine Drittschadensliquidation erübrigt.
Die künftigen Sozialleistungen der Sozialversicherungsträger sind aber nicht uferlos zu ersetzen. Bei wertender Betrachtung handelt es sich nämlich bei diesen um einen normativen Schaden des Verletzten, dem die späteren Sozialleistungen des Sozialversicherungsträgers zugerechnet werden (BGH, Urt. v. 10.11.1998 – VI ZR 354/97 Rn. 12, 19). Ohne Annahme eines normativen Schadens liefe der Regress stets ins Leere (BGH, Urt. v. 22.11.2016 – VI ZR 40/16 Rn. 15). Daher regelt § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X, dass die spätere Sozialleistung des Sozialversicherungsträgers der Behebung eines Schadens der gleichen „Art“ dienen und sich auf denselben Zeitraum wie der vom Schädiger zu leistende Schadensersatz beziehen muss (zeitliche und sachliche Kongruenz; die zeitliche Kongruenz spielt bei der Problematik hier keine Rolle). Die sachliche Kongruenz besteht, wenn sich die Ersatzpflicht des Schädigers und die Leistungsverpflichtung des Sozialversicherungsträgers ihrer Bestimmung nach decken. Hiervon ist auszugehen, wenn die Leistung des Versicherungsträgers und der vom Schädiger zu leistende Schadensersatz dem Ausgleich derselben Einbuße des Geschädigten dienen. Es genügt, wenn der Sozialversicherungsschutz seiner Art nach den Schaden umfasst, für den der Schädiger einstehen muss. Es kommt nicht darauf an, ob auch der einzelne Schadensposten vom Versicherungsschutz gedeckt ist (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 14). Es geht somit grundsätzlich nur darum, ob die geltend gemachten Schadenspositionen überhaupt zu den vom Übergang erfassten abstrakten „Schadensarten“ gehören (Heilungskosten, Erwerbsschaden und vermehrte Bedürfnisse), die auch dem Geschädigten zustehen (BGH, Urt. v. 30.06.2015 – VI ZR 379/14).
Die hier maßgebliche Krankenbehandlung ist als Sachleistung grundsätzlich sachlich kongruent mit der Verpflichtung des Schädigers, dem Geschädigten die Heilungskosten zu ersetzen. Die Krankenhauskosten der gesetzlichen Krankenversicherung stellen Sachleistungen gemäß den §§ 2 Abs. 2, 12 Abs. 2, 13 Abs. 1 SGB V dar. Die Kosten ergeben sich aus den gemäß § 109 Abs. 4 Satz 3 SGB V i.V.m. § 7 KHEntgG und § 17b KHG abgeschlossenen und für alle Benutzer des Krankenhauses gültigen Versorgungsverträgen. Die Pflegesätze und die Vergütung für allgemeine Krankenhausleistungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KHG, § 8 Abs. 1 Satz 1 KHEntgG, § 14 Abs. 1 Satz 1 BPflV unabhängig vom Versichertenstatus für alle Benutzer des Krankenhauses einheitlich zu berechnen und für die Parteien des Krankenhausaufnahmevertrages sowie für die Abrechnung zwischen Sozialleistungsträgern und Krankenhäusern gleichermaßen bindend (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 15, 17 m.w.N.; BGH, Urt. v. 27.01.1954 – VI ZR 16/53 – BGHZ 12, 154, 155 f.; BGH, Urt. v. 09.11.1989 – IX ZR 269/87; zusf. Prelinger, NZV 2024, 233, 235).
Die Krankenkasse leistet somit dem Geschädigten die gesamte Heilbehandlung durch ihre medizinischen und therapeutischen Leistungserbringer als Sachleistung (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 10 m.w.N.; BGH, Urt. v. 29.06.2004 – VI ZR 211/03). Die Krankenkasse kann daher für diese „Sozialleistung“ vom Schädiger den Geldbetrag ersetzt verlangen, den sie an ihre jeweiligen Leistungserbringer zahlte (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 m.w.N.). Mit dem Begriff „Sozialleistung“ in § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X ist dieser konkret vom Schädiger zu ersetzende Schaden des Sozialversicherungsträgers gemeint, nicht etwa der nur abstrakte normative Schaden des Geschädigten. Die Kongruenz ist das Bindeglied zwischen dem nur normativen Schaden des Geschädigten und den erst nach dem Anspruchsübergang zu erbringenden konkreten „Sozialleistungen“ des Sozialversicherungsträgers.
Der BGH stellt zunächst zutreffend voran, dass sich das für den materiellen Schaden gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB maßgebliche Beweismaß nach § 287 Abs. 1 ZPO richtet (unverständlich daher OLG Jena, Urt. v. 15.05.2012 – 4 U 661/11 Rn. 61, OLG Hamm, Urt. v. 16.05.2023 – I-26 U 99/22 Rn. 41; OLG Stuttgart, Urt. v. 19.12.2023 – 12 U 17/23 Rn. 4, die hierfür den Vollbeweis gemäß § 286 Abs. 1 ZPO forderten). Allerdings habe das Berufungsgericht die an dieses Beweismaß zu stellenden Grundsätze verkannt.
Der BGH bejaht einen Verstoß gegen § 287 Abs. 1 ZPO und lehnt zugleich die Anwendung der subjektbezogenen Schadensbetrachtung für die Krankenkasse ab, da allein der „verletzte Versicherte“ und nicht die Krankenkasse Geschädigter sei (Rn. 11, 32). Die nach sozialversicherungsrechtlichen Grundsätzen zu erbringende Leistung der Krankenkasse sei „nicht zwingend deckungsgleich“ mit den im Sinne des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB erforderlichen Heilbehandlungsmaßnahmen. Der Sozialversicherungsträger könne den Ersatzpflichtigen nicht auf Ersatz des eigenen Schadens in Gestalt seiner durch den Versicherungsfall ausgelösten, vom Gesetzgeber angeordneten Leistungspflichten in Anspruch nehmen, er könne eine Erstattung seiner Aufwendungen nur insoweit verlangen, als sie „auf einen Schaden des Versicherten“ zu erbringen sind.
Bei Krankenhausleistungen gibt es dabei keine unterschiedlichen sozial- bzw. zivilrechtlichen Berechnungsarten. Die Pflegesätze und die Vergütung für allgemeine Krankenhausleistungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KHG, § 8 Abs. 1 Satz 1 KHEntgG, § 14 Abs. 1 Satz 1 BPflV unabhängig vom Versichertenstatus für alle Benutzer des Krankenhauses einheitlich zu berechnen und für die Parteien des Krankenhausaufnahmevertrages sowie für die Abrechnung zwischen Sozialleistungsträgern und Krankenhäusern gleichermaßen bindend. Die Krankenkasse hat die Kosten der Krankenhausbehandlung in gleicher Weise zu zahlen, wie sie auch ein selbstzahlender Patient zahlen müsste (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 15, 17; BGH, Urt. v. 27.01.1954 – VI ZR 16/53 – BGHZ 12, 154, 155 f.; BGH, Urt. v. 09.11.1989 – IX ZR 269/87; zusf. Prelinger, NZV 2024, 233, 235). Der Geschädigte bekäme daher als Selbstzahler eine inhaltsgleiche Abrechnung des Krankenhauses, § 17c Abs. 5 KHG.
Die Entscheidung des BGH vom 03.05.2011 (VI ZR 61/10) wurde vorliegend sogar vom BGH zitiert, aber deren Bedeutung verkannt. Diese Verkennung ist angesichts der Komplexität dieses Rechtsbereichs verständlich, allerdings wurde auf vorstehende Besonderheiten bereits hingewiesen (Prelinger, VersR 2022, 1337, 1339 zu 3 c). Die Ausführungen des BGH haben bereits zu Irritationen bei den Gerichten geführt, die sich jetzt fragen, was denn bei Heilbehandlungen der „eigene Schaden des Verletzten“ sei, der als gesetzlich Krankenversicherter doch gar keine Abrechnungen für die Heilbehandlung erhält und bezahlt (mit Ausnahme der Zuzahlung gemäß § 61 SGB V). Das LG Neubrandenburg hat sich davon nicht irritieren lassen und die Behandlungskosten der Krankenkasse zutreffend zuerkannt (LG Neubrandenburg, Urt. v. 20.11.2024 – 2 O 208/24).
Der konkrete Schaden gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB entsteht durch die Sachleistungen der Krankenkasse.
Die einzelnen konkreten Schadenspositionen, deren Ersatz im Rahmen des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB verlangt wird, können somit denklogisch nur bei der Krankenkasse als deren „Sozialleistungen“ entstehen und bestehen in dem Geldbetrag, den die Krankenkasse an ihre Leistungserbringer entrichten muss (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 10, 17; BGH, Urt. v. 27.01.1954 – VI ZR 16/53 – BGHZ 12, 154, 156; BGH, Urt. v. 29.06.2004 – VI ZR 211/03 Rn. 7-11; BGH, Urt. v. 10.11.1998 – VI ZR 354/97 Rn. 12). Bei Arzt- und Krankenhausbehandlungen geht dies aus § 630a Abs. 1 Halbsatz 2 BGB hervor, da die Krankenkasse „Dritter“ in diesem Sinne ist (BT-Drs. 17/10488, S. 18/19; Wagner in: MünchKomm BGB, 9. Aufl. 2023, § 630a BGB Rn. 20; Katzenmeier in: BeckOK BGB, 68. Ed. 01.11.2023, § 630a BGB Rn. 47).
Weil es sich bei den „Sozialleistungen“ um einen eigenen materiellen Schaden der Krankenkasse handelt, wurden der Krankenkasse auch die Befugnisse zur Abrechnungsprüfung gemäß den §§ 275 ff. SGB V eingeräumt.
Die zur Schadensbeseitigung erforderlichen medizinischen Behandlungen des Verletzten müssen somit durch die unfallbedingten Verletzungen verursacht worden sein. Die daraus resultierenden Kosten und damit wirtschaftlichen Schäden i.S.d. § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB entstehen aber unmittelbar allein der Krankenkasse durch ihre Zahlungen an ihre jeweiligen Leistungserbringer (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 10, 17).
c) Der BGH führt hingegen aus, dass der frühe Zeitpunkt des Anspruchsübergangs bereits nach einer „logischen Sekunde“ nichts daran ändere, dass – zutreffend – der Anspruch des Geschädigten bestehen müsse und der Sozialversicherungsträger keinen eigenen „Anspruch“ geltend machen könne. Hierbei wurde verkannt, dass das Oberlandesgericht gar nicht von einem originär eigenen „Anspruch“ der Krankenkasse ausging, sondern richtigerweise von einem übergegangenen, originär fremden Anspruch des Geschädigten, aber von einem eigenen „Schaden“ der Krankenkasse in Gestalt der nach dem Anspruchsübergang erbrachten „Sozialleistungen“ (vgl. OLG Naumburg, Urt. v. 06.07.2023 – 9 U 125/22 Rn. 43; vgl. auch Prelinger, NZV 2024, 233, Rn. 4).
Der BGH führte weiter aus, dass das OLG Naumburg die Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast der Klägerin hinsichtlich der Schadenshöhe rechtsfehlerhaft verkannt habe, den Sozialversicherungsträger träfen die gleichen Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast, wie den Geschädigten selbst, als würde er den Schadensersatzanspruch selbst geltend machen.
Weder die Regelung des § 116 SGB X noch der Gedanke, den Belangen der Sozialversicherungsträger im Regress Rechnung zu tragen, ließen eine Abweichung von diesen Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast der Klägerin bzw. deren „Besserstellung“ zu. Der Gesetzgeber habe für den Forderungsübergang nach § 116 SGB X keine „Änderung“ der Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Schadenshöhe für die hier im Streit stehenden Krankenhauskosten und Kosten einer Rehabilitationseinrichtung zugunsten von gesetzlichen Krankenkassen vorgenommen.
Diese Ausführungen gehen ebenfalls ins Leere. Hier wurde bereits das Problem verkannt. Es ging niemals darum, dass die Krankenkassen eine zivilprozessuale „Besserstellung“ verlangen oder die zivilprozessualen Darlegungs- und Beweisgrundsätze in Frage gestellt werden (vgl. Prelinger, NZV 2024, 233, 234; Prelinger, VersR 2022, 1337). Es ist vielmehr bei der Darlegung des Schadens gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB bei der Auslegung des Begriffs „erforderlich“ – wie beim Geschädigten selbst – auf die individuellen Besonderheiten der Krankenkassen Rücksicht zu nehmen, da auch diese wegen der geringen Prüfmöglichkeiten gemäß den §§ 275, 275c SGB V kaum Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten hinsichtlich der Erbringung, Erforderlichkeit und Abrechnung der Krankenhauskosten haben. Damit wird nur eine Gleichstellung mit den für den Geschädigten anerkannten Darlegungserleichterungen im Rahmen der subjektbezogenen Schadensbetrachtung erreicht.
a) Zur Begründung bezieht sich der BGH auf § 116 Abs. 8 SGB X, wonach die Krankenkasse bei nicht-stationären ärztlichen Behandlungen und bei der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln über ein Wahlrecht verfügt, diese konkret nach den Abrechnungen der Leistungserbringer oder pauschal zu berechnen. Dieses bisher nirgends angeführte Argument entstammt scheinbar dem Urteil vom 23.02.2010 (VI ZR 331/08 Rn. 13), in welchem der BGH erkannte, dass dies nur für Behandlungskosten gelte und nicht für eine abstrakte Berechnung des dort streitigen Erwerbsschadens. Vorliegend führte der BGH hierzu aus, dass es in der Gesetzesbegründung dazu heiße, dass die ärztliche Behandlung im Krankenhaus bisher schon „genau abgerechnet“ wurde. Vor diesem Hintergrund sei vorliegend weder ersichtlich, dass Sinn und Zweck des § 116 SGB X eine „Absenkung“ der Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Schadenshöhe im Streitfall gebieten würden, noch könne davon ausgegangen werden, dass eine unbeabsichtigte Regelungslücke vorliegt. Diese Ausführungen sind völlig unverständlich.
Dieses Argument passt schon historisch nicht, da die vom BGH angeführte BT-Drs. 9/1753, S. 44 f. von 1983 stammt. Das DRG-System, infolgedessen die Prüfungseinschränkungen erst zunehmend erforderlich wurden, wurde erst 2003 und somit 20 Jahre später eingeführt (zusf. Prelinger, VersR 2022, 1337, 1344 m.w.N.).
Auch wurde verkannt, dass es nur um die Auslegung des Begriffs „erforderlich“ in § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB geht.
Vor allem aber geht es vorliegend auch nicht um eine pauschale Berechnung der Krankenhauskosten. Diese werden – wie der BGH selber ausführte – „genau abgerechnet“ nach den in den Versorgungsverträgen gemäß § 109 Abs. 4 Satz 3 SGB V i.V.m. § 7 KHEntgG und § 17b KHG vereinbarten Kosten.
Mit dieser Begründung hat der BGH die Anwendung des § 116 SGB X für die Kinderheilbehandlung auf nicht rentenversicherte Familienmitglieder erstreckt (BGH, Urt. v. 19.01.2021 – VI ZR 125/20 Rn. 10). Der BGH erkannte daher auch, dass dem Geschädigten als Selbstzahler der Investitionskostenzuschlag zu ersetzen ist, da der Schädiger ansonsten ungerechtfertigt bessergestellt wäre, bekäme die Krankenkasse ihn nicht ebenso ersetzt (BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 17). Auch hinsichtlich der Pflicht des Schädigers zum Ersatz der Rentenversicherungsbeiträge für die Pflegeperson erkannte der BGH, dass diese nicht dem Schädiger zugutekommen soll (BGH, Urt. v. 10.11.1998 – VI ZR 354/97 Rn. 19).
Das Schutzbedürfnis des Sozialversicherungsträgers wurde ausnahmsweise nur dort abgelehnt, wo bereits zum Zeitpunkt des Anspruchsübergangs konkrete Einwendungen und Einreden des Schädigers bestanden, denn diese waren in Hinblick auf die §§ 412, 404 BGB zu beachten (BGH, Urt. v. 24.04.2012 – VI ZR 329/10 Rn. 21; BGH, Urt. v. 04.10.1983 – VI ZR 194/81). Ausgerechnet diesen – insbesondere bei Krankenkassen seltenen – Ausnahmefall hat der BGH nun plötzlich zur Regel erhoben (Rn. 21), obwohl der BGH sogar bereits 2021 klargestellt hatte, dass es sich um eine Ausnahme für bereits vor Begründung des Sozialversicherungsverhältnisses bestehende Einwendungen und Einreden handelt (BGH, Urt. v. 19.01.2021 – VI ZR 125/20 Rn. 13; vgl. auch BGH, Urt. v. 18.10.2022 – VI ZR 1177/20).
Auch der Gesetzgeber stellte klar, dass eine unbillige Entlastung des Schädigers nicht erfolgen soll, es besteht ein grundsätzliches Interesse der Solidargemeinschaft, dass für die durch das schädigende Ereignis entstandenen Aufwände für Sozialleistungen, wie von der Grundregelung des § 116 Abs. 1 SGB X vorgesehen, verursachergerecht die schädigende Person aufkommt (Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze – Regierungsentwurf vom 13.12.2019, S. 136; vgl. Prelinger, VersR 2022, 1337, 1344). Unverständlich ist, dass der BGH auch dies übergeht.
Der BGH führt weiter aus, dass sozialrechtliche Anforderungen an das Abrechnungssystem der Krankenhäuser sowie sozialrechtliche Anforderungen an die Datenübermittlung, Prüfung von Rechnungen und Zahlungspflichten der Krankenkassen keine Abweichung von den zivilrechtlichen Grundsätzen der Darlegungs- und Beweislast nach dem Forderungsübergang gemäß § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X rechtfertigten. Die §§ 275, 275c SGB V und die §§ 284 bis 303 SGB V und das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) würden ausschließlich Rechte und Pflichten von Sozialversicherungsträgern und Leistungserbringern festlegen, aber nicht das Verhältnis zum Schädiger im Rahmen der zivilrechtlichen Haftung regeln.
Auch dies ist nicht zutreffend, es geht nicht um die Einschränkung von Rechten des Schädigers, sondern um die Rücksichtnahme auf die eingeschränkten Prüf- und Einwirkungsmöglichkeiten des schutzbedürftigen Geschädigten. Hier wird verkannt, dass der BGH diese angebliche „Grenzüberschreitung“ bzw. das „Beschneiden“ von Rechtspositionen des Schädigers selber mittels der subjektbezogenen Schadensbetrachtung zugunsten des Geschädigten in ständiger Rechtsprechung akzeptiert und daher erneut im Januar 2024 gleich mehrmals wieder bestätigte, dass der gutgläubige Geschädigte auf die Abrechnung einer Werkstatt vertrauen darf, auch wenn diese falsch war, die abgerechneten Leistungen nicht erbracht wurden oder nicht erforderlich waren (vgl. BGH, Urteile v. 16.01.2024 – VI ZR 239/22, VI ZR 253/23, VI ZR 51/23, VI ZR 38/22). Insbesondere gilt die subjektbezogene Schadensbetrachtung auch für Personenschäden (zuletzt BGH, Urt. v. 08.10.2024 – VI ZR 250/22). Diese Grundsätze stellen nur eine konkrete Auslegung des Begriffs der „Erforderlichkeit“ in § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB dar, die zu Recht auf die eingeschränkten Einwirkungs- und Prüfmöglichkeiten des Geschädigten abstellt, wie sie ebenfalls für eine Krankenkasse bei nicht prüfbaren Krankenhausabrechnungen bestehen.
Insbesondere wird die überragende Bedeutung des qualifizierten Datensatzes nach § 301 SGB V verkannt, der die für die Krankenhauskosten maßgeblichen Abrechnungsdaten enthält. § 301 Abs. 1 SGB V zählt abschließend auf, welche Angaben ein Krankenhaus der Krankenkasse übermitteln darf. Das Gesetz geht davon aus, dass die dortigen Angaben zum tatsächlichen Behandlungsgeschehen zutreffend und vollständig sind. Die Regelung gebietet nämlich, wahre Angaben zum Behandlungsgeschehen zu machen, die Fehlvorstellungen der Kassen über das konkrete abrechnungsrelevante Geschehen ausschließen (BSG, Urt. v. 19.12.2017 – B 1 KR 19/17 R). Mit der Abrechnung erfolgt die implizite Tatsachenbehauptung des Krankenhauses, es habe beim Versicherten die Befunde erhoben, die die angegebene Diagnose als rechtlich relevanten Abrechnungsbegriff rechtfertigen, und die medizinischen Behandlungen durchgeführt, die die tatbestandlichen Voraussetzungen der kodierten Operation oder Prozedur erfüllen (BSG, Urt. v. 23.05.2017 – B 1 KR 28/16 R). In dem Datensatz sind somit die für die Prüfung der Höhe des Leistungsbetrags wesentlichen Daten enthalten, die eine rechnerische Überprüfung der Krankenhausabrechnungen ermöglichen (BT-Drs. 12/3608, S. 124; BT-Drs. 14/1245, S. 106; BVerfG, Beschl. v. 26.11.2018 – 1 BvR 318/17, 1 BvR 1474/17, 1 BvR 2207/17 – NJW 2019, 351; BSG, Urt. v. 16.05.2012 – B 3 KR 14/11 R; zusf. Prelinger, NZV 2024, 233, 240 Rn. 51 m.w.N.; Prelinger, VersR 2022, 1337, 1343 m.w.N.; Prelinger, jurisPR-MedizinR 12/2019 Anm. 3 m.w.N.). Gerade weil sich die Schadenshöhe nur aus dem Rechtsverhältnis zwischen Zedenten und Zessionar ergeben kann (vgl. oben), muss auch zivilrechtlich diesen Besonderheiten Rechnung getragen werden.
Hinsichtlich des „Werkstattrisikos“ führt der BGH aus, dass die im Fall der Beschädigung einer Sache anerkannten Grundsätze auf den von einer gesetzlichen Krankenkasse geltend gemachten Ersatz der Kosten der Heilung nicht übertragbar seien. Das „Werkstattrisiko“ sei von dem Gedanken geprägt, dass es Sinn und Zweck des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB widerspreche, wenn der Geschädigte bei Ausübung der ihm durch das Gesetz eingeräumten Ersetzungsbefugnis – sei es aus materiell-rechtlichen Gründen oder aufgrund der Beweislastverteilung – im Verhältnis zu dem ersatzpflichtigen Schädiger mit Mehraufwendungen der Schadensbeseitigung belastet bliebe, deren Entstehung seinem Einfluss entzogen ist und die ihren Grund darin haben, dass die Schadensbeseitigung in einer fremden, vom Geschädigten, wohl auch nicht vom Schädiger kontrollierbaren Einflusssphäre stattfinden muss. Unter diesen Umständen bestehe kein Sachgrund, dem Schädiger das „Werkstattrisiko“ abzunehmen, das er auch zu tragen hätte, wenn der Geschädigte ihm die Beseitigung des Schadens nach § 249 Abs. 1 BGB überlassen würde. Die dem Geschädigten durch § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB gewährte Ersetzungsbefugnis sei kein Korrelat für eine Überbürdung dieses Risikos auf ihn.
Nach diesen verfänglichen Ausführungen, die für das Urteil des Berufungsgerichts sprachen, weicht der BGH aber einfach auf seine anfänglichen Ausführungen (bei Rn. 11 ff.) aus, dass die Krankenkasse nicht „Geschädigter“ sei, die sozialrechtlich zu erbringende Leistung der Krankenkasse sei nicht zwingend deckungsgleich mit den i.S.d. § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB „erforderlichen“ Heilbehandlungsmaßnahmen, auch bemesse sich der Schaden nach unterschiedlichen Grundsätzen und ohnehin trage der Zessionar das Werkstattrisiko.
§ 249 Abs. 2 Satz 1 BGB stellt Personen- und Sachschäden gleich. Die subjektbezogene Schadensbetrachtung ist daher auch bei Personenschäden anerkannt (BGH, Urt. v. 08.10.2024 – VI ZR 250/22 Rn. 10; BGH, Urt. v. 18.10.1988 – VI ZR 223/87 Rn. 17; BGH, Urt. v. 11.11.1969 – VI ZR 91/68; OLG Hamm, Urt. v. 17.10.1994 – 3 U 11/94; OLG Hamm, Urt. v. 15.03.2006 – 3 U 131/05 Rn. 30; OLG Hamm, Urt. v. 24.10.2007 – I-3 U 14/07 Rn. 70; OLG Celle, Urt. v. 30.05.2007 – 14 U 189/06 Rn. 56). Die für den Geschädigten geltenden Darlegungserleichterungen müssen daher erst recht auch bei Abrechnungen wegen Krankenhauskosten des Geschädigten gelten, wenn dieser Selbstzahler ist. Denn gemäß § 17c Abs. 5 KHG erhält der Selbstzahler – wie die Krankenkasse – die Krankenhausabrechnung nach den allgemeingültigen und daher auch für Selbstzahler zwingenden sozialgesetzlich vorgesehenen Kostenregelungen und Versorgungsverträgen, was für einen Gleichlauf von Selbstzahler und Krankenkasse spricht (vgl. BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 15, 17).
Es würde eine ungerechtfertigte Besserstellung des Schädigers darstellen, wenn es zu einer Ungleichbehandlung von Selbstzahler und Krankenkasse dadurch kommt, dass die Krankenkasse nicht diejenigen Leistungen ersetzt bekommt, die auch dem Selbstzahler zu ersetzen wären (vgl. BGH, Urt. v. 03.05.2011 – VI ZR 61/10 Rn. 17). Der Krankenkasse ist verfassungsrechtlich die inhaltliche Prüfung der Krankenhausabrechnung aufgrund des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung grundsätzlich untersagt und nur in den ganz wenigen gemäß den §§ 275, 275c Abs. 2 SGB V im Rahmen der sog. quartalsbezogenen Prüfquoten zugelassenen Fällen von nur 5-15% gestattet (Gesetzesvorbehalt, zusf. Prelinger, NZV 2024, 233, 238 m.w.N.; Prelinger, VersR 2022, 1337, 1344; Prelinger, jurisPR-MedizinR 12/2019 Anm. 3 m.w.N.). Die Krankenkasse verfügt über keinerlei eigene Informationen und muss auf die Angaben des Krankenhauses gemäß § 301 SGB V vertrauen. Das Krankenhaus hat daher wahre Angaben zum Behandlungsgeschehen zu machen, die Fehlvorstellungen über das abrechnungsrelevante Geschehen ausschließen. Damit soll das bestehende Informationsgefälle zwischen dem rundum informierten Krankenhaus und der nur spärlich informierten Krankenkasse ausgeglichen werden (BSG, Urt. v. 18.12.2018 – B 1 KR 40/17 R m.w.N.).
Selbst wenn man also dem Urteil vom 09.07.2024 folgt und auf den Geschädigten abstellt, wäre ohnehin auf dessen Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten Rücksicht zu nehmen, als wenn ihm selbst die Rechnungen des Krankenhauses erteilt worden wären. Er kann diese inhaltlich aber überhaupt nicht prüfen und ist insoweit auch „Laie“. Hiernach ergeben sich hinsichtlich der Erbringung und Erforderlichkeit der abgerechneten medizinischen Leistungen nur die Möglichkeiten, dass entweder die Krankenkasse selber Geschädigte gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB ist – dann kommt es auf ihre nach den §§ 275 ff. SGB V begrenzten Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten bei nicht prüfbaren Krankenhausabrechnungen an – oder man stellt auf den Verletzten ab und berücksichtigt dessen noch viel begrenztere Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten als „Laie“. In beiden Fällen gelangt man zum selben Ergebnis. Der Inhalt der Krankenhausabrechnung ist ohnehin bei der Krankenkasse und dem Selbstzahler immer gleich, § 17c Abs. 5 KHG. Dass die Krankenkasse nicht schlechtergestellt werden soll als der Geschädigte, gab der BGH bereits im Urteil vom 03.05.2011 (VI ZR 61/10 Rn. 17) unmissverständlich vor. In beiden Konstellationen ist daher auf die eingeschränkten Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten Rücksicht zu nehmen. Soweit eine Rechnungsprüfung gemäß den §§ 275 ff. SGB V zulässig war, wären die Prüfergebnisse der Krankenkasse gemäß den §§ 275 ff. SGB V selbstverständlich stets zu berücksichtigen.
Vorstehendes gilt auch bei sonstigen Behandlungsrechnungen, denn auch dort kann der Geschädigte regelmäßig nicht die Erforderlichkeit und zutreffende Berechnung der Leistungen prüfen.
Der BGH führt abschließend aus, dass der Hinweis der Revisionserwiderung auf das Urt. v. 11.03.1986 (VI ZR 64/85 Rn. 8), wonach der Grundsatz gelte, dass der Schädiger sein Opfer in der Konstellation hinnehmen müsse, in der sich das Opfer befinde, in diesem Zusammenhang unbehilflich sei. Die Klägerin sei nicht Geschädigte und dieser Grundsatz sei im Zusammenhang mit gesundheitlichen Vorschäden des Geschädigten entwickelt worden.
Das ist unzutreffend, denn einerseits ist der Sozialversicherungsträger der materiell Geschädigte (vgl. oben). Andererseits verkennt der BGH, dass Vorschäden auch bei der subjektbezogenen Schadensbetrachtung gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB beachtlich sind. Denn der Schädiger hat den Geschädigten in den persönlichen und gesundheitlichen Verhältnissen zu entschädigen, in denen er ihn angetroffen hat. Daher sind die Heilbehandlungskosten des Geschädigten auch dann erforderlich, wenn sie sich durch Vorschäden erhöht haben (BGH, Urt. v. 18.10.1988 – VI ZR 223/87 Rn. 17; OLG Hamm, Urt. v. 24.10.2007 – I-3 U 14/07 Rn. 70; OLG Celle, Urt. v. 30.05.2007 – 14 U 189/06 Rn. 56; zusf. Prelinger, NZV 2024, 233, 237, Rn. 35).
Die Auswirkungen des Urteils sind angesichts der vielen Unpässlichkeiten erheblich. Die Thematik bedarf dringend der erneuten höchstrichterlichen Entscheidung.
Der Krankenkasse abzusprechen, dass sie hinsichtlich der konkreten „Sozialleistungen“ materiell Geschädigte i.S.d. § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB sei, ist unhaltbar, zumal längst das Gegenteil entschieden und vom BGH erkannt wurde (vgl. oben). Es verstößt gegen die Effektivität des Rechtschutzes gemäß Art. 103 Abs. 1 GG, wenn der Anspruchsübergang dazu dient, dem Sozialversicherungsträger den Ersatz der Kosten seiner (kausalen und kongruenten) „Sozialleistungen“ i.S.d. § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X zu ermöglichen und genau das nicht umsetzbar ist. Einen konkreten derartigen materiellen Schaden des Geschädigten gibt es nicht, die „Sozialleistungen“ der Krankenkasse müssen mittels der nötigen Kongruenz dem normativen Schaden des Geschädigten nur wertungsmäßig zurechenbar sein. Wenn beim Geschädigten dagegen ein konkreter materieller Schaden verbliebe, könnte dieser darüber verfügen, was § 116 Abs. 1 SGB X gerade verhindern soll (vgl. oben).
Die unkritische Hinnahme des Urteils im Lager der Haftpflichtversicherer klärt die aufgezeigten Probleme ohnehin nicht auf (vgl. Jahnke, jurisPR-VerkR 20/2024 Anm. 2; Figgener/Quaisser, NJW-Spezial 2024, 586; Fischer, FD-SozVR 2024, 820699; Lang/Nugel VersR 2025, 13 ff.). Vor allem aber überlagert die hiernach ergangene Entscheidung des BGH vom 08.10.2024 (VI ZR 250/22) die gesamte Thematik zugunsten der Krankenkassen. Denn wenn auf die nahezu gar nicht bestehenden Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten des Verletzten abzustellen wäre, dann müsste der Schädiger erst recht die Abrechnung ungeprüft ersetzen. Dann wären aber auch die fehlenden Prüfmöglichkeiten der Krankenkasse gemäß den §§ 275 ff. SGB V zu berücksichtigen.
Das OLG Naumburg ist gemäß § 563 Abs. 2 ZPO an die Rechtsauffassung des BGH gebunden, die Bindung erstreckt sich aber nicht auf den Sachverhalt, wenn es nach der Zurückverweisung andere Tatsachen feststellt oder seiner neuen Entscheidung aufgrund geänderter Verhältnisse einen abweichenden Sachverhalt zugrunde legt (OLG Stuttgart, Urt. v. 04.07.2016 – 5 U 186/12 Rn. 44 m.w.N.). Insbesondere wurde vom BGH nicht über die Frage entschieden, ob der Geschädigte selbst das „Krankenhausrisiko“ trägt und ob dies dann daran anknüpfend auch für die Krankenkasse gilt, was sich infolge des neuen Urteils vom 08.10.2024 (VI ZR 250/22) aufdrängt (vgl. oben). Auch dürfte eine Revision erneut geboten sein, da der BGH verkannte, dass das Oberlandesgericht nicht von einem eigenen Anspruch, sondern nur von einem eigenen materiellen Schaden der Krankenkasse ausging. Zudem wandte der BGH vorliegend § 275c SGB V in der seit 01.01.2020 geltenden Fassung an, obwohl sich der Unfall nebst Abrechnung bereits 2018 zutrug.
Dagegen, dass die Krankenkasse die konkreten Schadenspositionen mittels ihrer gemäß den §§ 284 Abs. 1 Nr. 11, 295, 299 bis 302 SGB V von den Leistungserbringern übermittelten EDV-Belege darlegen kann, hatte der BGH keine Einwendungen, zumal hierfür ohnehin das abgemilderte Beweismaß des § 287 Abs. 1 ZPO gilt.
Im Rahmen der subjektbezogenen Schadensbetrachtung sind dem Geschädigten, der auf den ärztlichen Rat vertraut und vertrauen darf, die Schäden auch dann zu ersetzen, wenn sie nicht objektiv erforderlich waren. In diesem Fall wären auch hinsichtlich der Schadenshöhe von der Krankenkasse keine weiteren Belege vorzulegen. Für die Gesundheitsschäden und Kausalitäten kann anderes gelten.
Der datenschutzrechtlich zulässige Umfang der dem Schädiger zu übersendenden Behandlungsunterlagen ist nicht geklärt. Die Übersendung der gemäß Art. 9 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. f DSGVO besonders geschützten Gesundheitsdaten ist nur bei entsprechender Erforderlichkeit zulässig, was außergerichtlich und gerichtlich zu berücksichtigen ist (präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, vgl. VG Stuttgart, Urt. v. 20.06.2024 – 14 K 870/22; VG Hamburg, Urt. v. 28.07.2022 – 21 K 1802/21). Eine pauschale Datenanforderung ist unzulässig (OLG Zweibrücken, Beschl. v. 30.05.2022 – 1 W 9/22). Die Übersendung der gesamten Patientenakte ist nicht erforderlich, es muss vielmehr stets der konkrete fallbezogene Zweck der einzelnen Beleganforderung vom Schädiger dargelegt werden. Für die Gesundheitsschäden und Kausalitäten dürften Entlassungsberichte grundsätzlich ausreichen. Die Abrechnungsdaten des Krankenhauses gemäß § 301 Abs. 1 SGB V genügen auch nach der Entscheidung vom 09.07.2024 für den Nachweis der Schadenshöhe (LG Neubrandenburg, Urt. v. 20.11.2024 – 2 O 208/24).
Datenschutzrechtlich ist es zudem unzulässig, dass nicht geeignete Personen die Gesundheitsdaten erhalten. In der Schadensregulierung bleibt regelmäßig im Unklaren, welche Personen genau aufseiten der Dienstleister von Haftpflichtversicherungen mit welcher Qualifikation die sensiblen Gesundheitsdaten prüfen und die Prüfberichte zu verantworten haben. Insbesondere hinsichtlich der oft von Dienstleistern in Frage gestellten Gesundheitsschäden, Kausalitäten und – soweit noch relevant – die medizinische Erforderlichkeit von Behandlungen ist dies problematisch, denn diese können sachkundig nur Fachärztinnen und Fachärzte der jeweils einschlägigen Fachrichtung beurteilen. Dabei können mehrere Fachrichtungen pro Schadensfall relevant sein. Daher muss die Haftpflichtversicherung dies gewährleisten. Entsprechend sind die darauf erstellten Prüfberichte vollständig und unter prüfbarer Benennung der dies verantwortenden Person und ihrer fachärztlichen Qualifikation der Krankenkasse zu übermitteln. Ansonsten sind Einwendungen unsubstanziiert und unbeachtlich. Zur Prüfung und Verteidigung von Ansprüchen sind diese Auskünfte den Haftpflichtversicherungen – trotz oftmals anderslautender Behauptung – auch stets rechtlich möglich, § 24 Abs. 1 Nr. 2 BDSG.
Im Zivilprozess spielen die Behandlungsunterlagen zunächst ohnehin keine Rolle, denn wie der BGH hier zutreffend ausführt, genügt eine Partei ihrer Darlegungslast, wenn sie Tatsachen anführt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht als entstanden erscheinen zu lassen (vgl. auch BGH, Urt. v. 18.05.2021 – VI ZR 401/19; BGH, Beschl. v. 26.03.2019 – VI ZR 163/17; BGH, Beschl. v. 27.09.2016 – VI ZR 565/15). Unsubstanziiert ist ein Vortrag daher nur bei Fehlen jeglicher Anhaltspunkte (BVerfG, Beschl. v. 24.01.2012 – 1 BvR 1819/10; BGH, Beschl. v. 11.01.2022 – VIII ZR 33/20 m.w.N.; BGH, Urt. v. 18.05.2021 – VI ZR 401/19 m.w.N.). Zudem muss sich die Klagepartei kein medizinisches Fachwissen aneignen (BGH, Beschl. v. 28.05.2019 – VI ZR 328/18 m. Anm. Prelinger, jurisPR-VersR 1/2020 Anm. 1; BGH, Beschl. v. 12.03.2019 – VI ZR 278/18; BGH, Urt. v. 19.02.2019 – VI ZR 505/17; BGH, Urt. v. 14.03.2017 – VI ZR 605/15). Der Vortrag zur Erbringung und Erforderlichkeit der abgerechneten Leistungen mittels Darstellung der öffentlich-rechtlichen EDV-Belege, welche die sozialrechtlich geregelten nötigen und aussagekräftigen Angaben der Leistungserbringer enthalten, kann per se nicht unsubstanziiert sein. Soweit außergerichtlich nicht die erforderlichen Belege vorgelegt wurden, kann sich das allenfalls gemäß den §§ 119 Abs. 3, 120 VVG, § 286 Abs. 4 BGB auf die Zinsen und Kosten auswirken (OLG Stuttgart, Urt. v. 25.07.2024 – 2 U 26/23; OLG Stuttgart, Urt. v. 30.07.2024 – 12 U 130/23).
Die Entscheidung des BGH ist auch hinsichtlich etwaiger anschließender Rechtsstreitigkeiten problematisch. Denkbar ist, dass die Krankenkasse gegenüber dem Krankenhaus nunmehr zivilrechtliche Bereicherungsansprüche aus den §§ 812 ff. BGB geltend macht, wenn sich herausstellt, dass Behandlungen sozialrechtlich falsch abgerechnet wurden. Im Klageverfahren müsste gemäß den §§ 72 ff. ZPO der Streit verkündet werden. Hier besteht das Problem, ob die §§ 275 ff. SGB V eine Sperrwirkung entfalten bzw. bei nicht prüfbarer Abrechnung einen Rechtsgrund für die Zahlung bilden. Problematisch ist auch der Rechtsweg, da auch die Sozialgerichte zuständig und damit eine zivilprozessuale Streitverkündung wirkungslos sein könnte.
Der BGH führt zur Untermauerung seiner Auffassung, dass die sozialrechtlichen Systemanforderungen keine Abweichung von der zivilrechtlichen Darlegungs- und Beweislast nach sich ziehen, die Regelung des § 294a SGB V an. Dieser verpflichte unter anderem Krankenhäuser gemäß § 108 SGB V, „die erforderlichen Daten“, einschließlich der Angaben über Ursachen und mögliche Verursacher, den Krankenkassen mitzuteilen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Krankheit die Folge eines Unfalls ist. Der Gesetzgeber habe mit § 294a SGB V eine Norm geschaffen, mit der Krankenkassen Angaben zur Verfügung gestellt werden sollen, die sie benötigen, um nach § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X auf sie übergegangene Schadensersatzansprüche geltend machen zu können.
Diese Ausführungen sind unverständlich, denn § 294a SGB V sagt nichts über die zivilrechtliche Darlegungs- und Beweislast aus. Die Regelung setzt zudem voraus, dass die Krankenkassen diese Daten auch erhalten. Aus der Praxis ist hingegen bekannt, dass Ärzte und Krankenhäuser fast nie dieser Verpflichtung nachkommen und die Norm daher weitgehend gegenstandslos ist.
§ 294a SGB V regelt auch nur die Mitteilungspflicht der Leistungserbringer, da § 294a SGB V systematisch bei den Pflichten der Leistungserbringer eingeordnet wurde und diese von ihrer Schweige- und Datenschutzpflicht befreien sollte. Aus einer einseitigen Pflicht eines Leistungserbringers wird öffentlich-rechtlich keine Rechtsgrundlage zur aktiven Anforderung von Belegen. Ein Anfordern würde bereits eine Datenerhebung darstellen, für die es einer verfassungsgemäßen Rechtsgrundlage bedarf, die dem Grundsatz der Normenklarheit und Verhältnismäßigkeit entspricht. Bei § 294a SGB V ist diese Befugnis unklar (vgl. LSG Celle-Bremen, Urt. v. 11.11.2009 – L 1 KR 152/08; AG Magdeburg, Urt. v. 19.11.2008 – 180 C 2825/07; SG Berlin, Urt. v. 01.06.2004 – S 82 KR 2038/02; SG Potsdam, Beschl. v. 27.03.2008 – S 1 KA 191/06, zusf. Prelinger, VersR 2022, 1337, 1341; Prelinger, NZV 2024, 233, 242, Rn. 66).
Autor
Wolfdietrich Prelinger, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht, Fachanwalt für Versicherungsrecht
Erscheinungsdatum
20. Dezember 2024
Anmerkung zu BGH, Urteil vom 9. Juli 2024 - VI ZR 252/23
Artikel in juris öffnen https://www.juris.de/perma?d=jpr-NLMZ000005224
Quelle
Fundstelle
jurisPraxisReport-Medizinrecht 12/2024 Anm. 1
Zitiervorschlag
Prelinger, jurisPR-MedizinR 12/2024 Anm. 1
Nachweispflichten des Sozialversicherungsträgers beim Regress nach § 116 Abs. 1 SGB X: Besprechung des Urteils des OLG Naumburg vom 6.7.2023, Az. 9 U 125/22, nachgehend BGH, Az. VI ZR 252/23 (Prelinger NZV 2024, 232 - 244)
Beim Übergang gemäß § 116 SGB X kommt es auf den Anspruch an, wie er in Person des Geschädigten entsteht. Das gilt nicht für die Schadenshöhe, dader Forderungsübergang bereits nach einer logischen Sekunde nur dem Grunde nacherfolgt . Die Behandlungskosten entstehen danach. Die §§ 412, 404 BGB greifen nicht für die Schadenshöhe. Die Behandlungen müssen durch die vorfallsbedingten Gesundheitsschäden verursacht worden sein (haftungsausfüllende Kausalität), die regressierbaren Kosten entstehen aber nach sozialrechtlicher Maßgabe. Die Krankenkasse fängt die Behandlungskosten auf, so dass die nicht den Geschädigten treffen.
Die Behandlungskosten stellen stets einen sachlich kongruenten Schaden dar.
Die Schadenshöhe richtet sich nach dem Geldbetrag, den die Krankenkasse an ihre jeweiligen Leistungserbringer entrichtete. Dabei sind die geringen Prüf- und Einwirkungsmöglichkeiten der Krankenkasse zu beachten (subjektsbezogene Schadensbetrachtung). Wenn Abrechnungsfehler äußerlich nicht erkennbar sind, muss dies vom Schädiger hingenommen werden.
Die sozialrechtlichen Gesundheitsdaten genügen zum Nachweis der Schadenshöhe.
Eine Schadensminderungspflicht der Krankenkasse besteht nicht. Auch besteht kein Zurückbehaltungsrecht des Schädigers.
Autor
Wolfdietrich Prelinger, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht, Fachanwalt für Versicherungsrecht
Erscheinungsdatum
8. Mai 2024
Anmerkung zu OLG Naumburg, Urteil vom 6. Juli 2023, Az. 9 U 125/22
Quelle
Fundstelle
Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht NZV 2024, 232-244
Zitiervorschlag
Prelinger NZV 2024, 232 ff.
Zur Annahme einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gemäß § 116 Abs. 6 SGB X (a.F.) neben einer bestehender Ehe - OLG Karlsruhe, Urteil vom 7. Februar 2023 – 25 U 46/21 (Fundstellen: juris, NJW-RR 2023, 944 ff., DAR 2023, 565)
Tenor
- Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Konstanz vom 10.12.2020, Az. 2 O 127/18, wird zurückgewiesen.
- Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
- Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Das in Ziffer 1 genannte Urteil des Landgerichts Konstanz ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Zwangsvollstreckung durch die Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aus dem Endurteil vollstreckbaren Betrages abwenden, sofern nicht die Klägerin vor der Vollstreckung ihrerseits Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
- Die Revision gegen dieses Urteil wird nicht zugelassen.
Gründe
I.
Die Parteien, zwei Versicherungsunternehmen, streiten sich nach einem Verkehrsunfall zwischen ihren jeweiligen versicherten Personen über den Eintritt eines Forderungsübergangs nach § 116 Abs. 1 SGB X a.F.
Am 16.09.2016 beabsichtigte der zwischenzeitlich am 10.04.2019 verstorbene Herr T. mit seinem bei der Klägerin haftpflichtversicherten Fahrzeug gemeinsam mit der Zeugin L., die bei der Beklagten krankenversichert ist, eine Fahrt zu unternehmen. Während Herr T. mit laufendem Motor vor dem Hausanwesen in B. wartete, setzte er mit seinem Fahrzeug zurück und erfasste hierbei die sich dem Fahrzeug nähernde Zeugin L..
Die Zeugin L. wurde durch den Anstoß zu Boden geworfen. Sie erlitt hierdurch mehrere schwere Verletzungen, insbesondere ein Schädelhirntrauma und einen Schädelbasisbruch. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht und in ein künstliches Koma versetzt. In der Folge wurden verschiedene hochinvasive Behandlungen vorgenommen.
Aufgrund dieser Maßnahmen leistete die Beklagte als Krankenversicherer der Zeugin L. insgesamt 71.208,97 €.
Diesen Betrag forderte sie gemäß § 116 SGB X a.F. aus vermeintlich übergegangenem Recht von der Klägerin als Kfz-Haftpflichtversicherung des Herrn T. an und erhielt diesen auch von der Klägerin mit Zahlung vom 03.01.2017 erstattet.
Mit Schreiben vom 29.08.2017 (Anlage BLD 2) machte die Klägerin gegenüber der Beklagten geltend, dass sie den Betrag zu Unrecht geleistet habe, weil Herr T. und die Zeugin L. zum Unfallzeitpunkt in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelebt hätten, und forderte die Beklagte bis zum 30.09.2017 auf, den Betrag zurückzuerstatten.
Nachdem die Beklagte auch auf ein Schreiben vom 24.01.2017 (Anlage BLD 3) nicht geleistet hatte, beauftragte sie ihre Prozessbevollmächtigten mit der außergerichtlichen Durchsetzung ihrer Ansprüche (Anlage BLD 4).
Herr T. heiratete im Jahr 1975 die Zeugin Carola T.; aus der Ehe gingen zwei zwischenzeitlich erwachsene gemeinsame Kinder hervor, die wiederum eigene Kinder haben.
Er betrieb bis zu seinem Tod am 10.04.2019 mit der Zeugin T. verschiedene Handelsfirmen, die im Unfallzeitpunkt im Jahr 2016 ihren jeweiligen Sitz in B. hatten. In diesem Zusammenhang führten die Eheleute bis zum Tod des Herrn T. gemeinsame Konten und veranlagten sich steuerlich gemeinsam. Auch hatte Herr T. der Zeugin T. eine Generalvollmacht erteilt.
Die Zeugin L. hatte am 26.09.2004 den deutschen Staatsangehörigen Herrn L. geheiratet, von dem sie aber mit Urteil des Amtsgerichts W. am 03.08.2010 (Anlage B 6) rechtskräftig geschieden wurde.
Am 08.08.2009 brachte die Zeugin L. das Kind C. T. zur Welt, dessen Vater nach dem Auszug aus dem Geburtseintrag Nr. G xxx des Standesamts der Stadt W. vom 29.11.2011 (AS. I 465) Herr T. ist.
Die Zeugin L. war als Angestellte der von Herrn T. (zumindest mit-) betriebenen Handelsfirmen M. Service GmbH (Zeitraum 2014 bis 2016) und M. Express GmbH (Zeitraum ab 2016) sozialversicherungspflichtig beschäftigt.
Zum Unfallzeitpunkt war Herr T. polizeilich unter der Anschrift X 24 in B. gemeldet, während die Zeugin L. polizeilich unter der Anschrift Y 2 in B. gemeldet war. Diese beiden Anschriften wurden von Herrn T. bei der Unfallaufnahme auch gegenüber der Polizei angegeben und so auf dem Unfallfragebogen erfasst.
Beide Grundstücke standen im Unfallzeitpunkt im Eigentum von Herrn T. und der Zeugin T.. Auch ihre gemeinsamen Handelsfirmen waren unter diesen Adressen gemeldet.
Nach dem Tod von Herrn T. trat die gesetzliche Erbfolge ein.
Die Klägerin hat gemeint, ihre Zahlung an die Beklagte sei ohne Rechtsgrund erfolgt, da Herr T. und die Zeugin L. zum Unfallzeitpunkt bereits seit ca. neun Jahren eine nichteheliche Lebensgemeinschaft gebildet hätten und deshalb das Familienprivileg des § 116 Abs. 6 SGB X greife.
Die Klägerin hat behauptet, Herr T. und die Zeugin L. hätten im Unfallzeitpunkt bereits seit drei Jahren mit ihrer gemeinsamen neunjährigen Tochter unter der Anschrift Y 2 in B. in einem gemeinsamen Haushalt gelebt, eine Abmeldung des Herrn T. von seiner früheren Anschrift X 24 in B. sei lediglich aus Nachlässigkeit unterblieben. Herr T. und die Zeugin L. hätten beide nach ihren Möglichkeiten wirtschaftlich zu der gemeinsamen Lebensführung beigetragen.
Von der nichtehelichen Lebensgemeinschaft habe die Klägerin erst am 12.06.2017 durch ein Schreiben eines anwaltlichen Vertreters der Zeugin L. erfahren.
Die Klägerin hat beantragt:
1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 71,208,97 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 71.208,97 € seit dem 01.10.2017, hilfsweise seit dem 16.02.2018 zu bezahlen.
2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin außergerichtliche Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 2.062,15 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 29.06.2018 zu bezahlen.
Die Beklagte hat beantragt: Die Klage wird abgewiesen.
Im Wege der Widerklage hat die Beklagte weiter beantragt:
Es wird festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten sämtliche weiteren über die bisherigen Zahlungen hinausgehenden Schäden zu ersetzen, die der Beklagten aus dem Schadensereignis vom 16.09.2016 gegen 15:45 Uhr auf dem Anwesen Y 2, B., OT M., durch die Verletzung der Frau L., Y 2, B., entstanden sind und noch entstehen werden.
Die Klägerin hat beantragt: Die Widerklage wird abgewiesen.
Die Beklagte hat gemeint, dass zwischen Herrn T. und der Zeugin L. keine nichteheliche Lebensgemeinschaft bestanden habe.
Entgegen der Behauptungen der Klägerin sei Herr T. nicht der biologische Vater der neunjährigen Tochter der Zeugin L.. Herr T. habe zum Unfallzeitpunkt auch nicht im Hausanwesen Y 2 in B. gewohnt, sondern gemeinsam mit der Zeugin T. und einer ehelichen Tochter in der gemeinsamen ehelichen Wohnung im Hausanwesen X 24 in B., wo sich auch sein Briefkasten befunden habe. Ein gemeinsames Wirtschaften mit der Zeugin L. habe nicht vorgelegen.
Die Beklagte hat zudem die Ansicht vertreten, dass gegen eine nichteheliche Lebensgemeinschaft auch die getrennte steuerliche Veranlagung und das Fehlen eines gemeinsamen Kontos sprächen. Auch sei im Zeitpunkt des Ablebens von Herrn T. keine Altersvorsorge für die Zeugin L. geschaffen gewesen, was ebenfalls gegen eine nichteheliche Lebensgemeinschaft spreche.
Eine Anwendung des § 116 Abs. 6 SGB X a.F. sei auch deshalb ausgeschlossen, weil Herr T. den Unfall vorsätzlich herbeigeführt habe, was sich aus den Umständen des Unfalls ergebe.
Außerdem sei eine Rückforderung der geleisteten Zahlungen gemäß § 814 BGB ausgeschlossen, weil der Klägerin das Vorliegen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft bei Zahlung bekannt gewesen sei.
Schließlich habe die Klägerin mit der Zahlung zugleich ein deklaratorisches Schuldanerkenntnis abgegeben und damit den Haftpflichtanspruch verbindlich anerkannt.
Das Landgericht hat Beweis erhoben durch die Vernehmung der Zeuginnen T. und L.. Hinsichtlich ihrer Angaben wird auf die Protokolle der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht vom 13.08.2020 (AS. I 471 ff.) und 30.10.2020 (AS. I 571 ff.) Bezug genommen.
Des Weiteren hat es die Verfahrensakte der Staatsanwaltschaft - Az.: xxx Js xxx/16 - beigezogen.
Wegen der weiteren Einzelheiten der erstinstanzlichen Feststellungen wird gem. § 540 ZPO auf die angefochtene Entscheidung Bezug genommen.
Das Landgericht hat der Klage mit Ausnahme eines Teils der Zinsforderung stattgegeben und die Widerklage abgewiesen.
Zur Begründung hat es ausgeführt, dass die Leistungen der Klägerin an die Beklagte ohne Rechtsgrund erfolgt und daher gemäß § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB zurück zu gewähren seien. Schadensersatzansprüche der Zeugin L. gegen die Beklagte gem. §§ 7, 18 StVG seien gem. § 116 Abs. 1 SGB X a.F. analog nicht auf die Klägerin übergangen, weil zum Unfallzeitpunkt zwischen Herrn T. und der Zeugin L. eine nichteheliche Lebensgemeinschaft bestanden habe und beide in einer häuslichen Gemeinschaft gelebt hätten. Künftige Zahlungspflichten der Klägerin gegenüber der Beklagten aus dem streitgegenständlichen Unfall würden deshalb ebenfalls ausscheiden.
Dies stehe nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zur Überzeugung des Gerichts fest. Aus den glaubhaften Angaben der Zeuginnen T. und L. ergebe sich, dass Herr T. bereits im Jahr 2008 eine Beziehung zu der Zeugin L. aufgenommen und diese im Juli 2008 seiner Ehefrau, der Zeugin T., offenbart habe. Die Zeugin T. habe sich darauf hin von Herrn T. getrennt, sei nach Österreich verzogen und nur noch selten in B. zu Besuch gewesen.
Die Zeugin L. und Herr T. hätten seit 2009 zusammen mit der gemeinsamen Tochter C. in einem gemeinsamen Haushalt gelebt, und zwar zunächst in W. und später in dem Hausanwesen Y 2 in B.. Die Wohnung habe aus einem großen Wohnzimmer, zwei Schlafzimmern, Küche und Bad bestanden. Eines der Schlafzimmer habe die Tochter C. T. genutzt, das andere Schlafzimmer hätten Herr T. und die Zeugin L. gemeinsam genutzt. Herr T. und die Zeugin L. hätten ihre Tochter gemeinsam erzogen und die Ausgaben für den Haushalt gemeinsam aus ihrem jeweiligen Einkommen bestritten.
Insgesamt habe sich das damalige Verhältnis zwischen Herrn T. und der Zeugin L. als Lebensgemeinschaft dargestellt, die sich von einer Ehe nur durch die fehlende rechtliche Bindung unterschieden habe. Dem stehe der rein formale Fortbestand der Ehe zwischen Herrn T. und der Zeugin T. nicht entgegen, da zwischen ihnen seit der Trennung im Jahr 2008 keine Lebensgemeinschaft mehr bestanden habe.
Die von der Beklagten behaupteten Unstimmigkeiten hinsichtlich der Klingel- und Briefkastenschilder an den Anschriften Y 2 und X 24 in B. gäben ebenso wenig wie die unterschiedlichen Meldeadressen Aufschluss über die tatsächlichen Wohn- und Lebensumstände des Herrn T. und der Zeugin L.. Da beide Anwesen ausweislich des von der Beklagten vorgelegten Luftbildes in fußläufiger Entfernung lägen, sei es unproblematisch, wenn die Post teilweise an die eine, teilweise an die andere Anschrift gesendet worden sei. Es habe auch keine zwingende Notwendigkeit bestanden, dass Herr T. seine Meldeadresse habe ändern müssen.
Für die Annahme einer vorsätzlichen Herbeiführung des Unfalls würden jegliche Anhaltspunkte fehlen, der dahingehende Vortrag der Beklagten erfolge ins Blaue hinein und sei in sich widersprüchlich, wenn in dem Schriftsatz vom 04.01.2019 von der Beklagten auf Seite 6 oben mitgeteilt werde, dass auch sie von einem fahrlässigen Ereignis ausgehe. Um einen Fall des zulässigen Haupt- und Hilfsvorbringens handele es sich insoweit gerade nicht. Letztlich ergäben sich aber auch aus der beigezogenen Verfahrensakte der Staatsanwaltschaft keine konkreten Anhaltspunkte für eine solche Annahme.
Ein Ausschluss der Forderung der Klägerin nach § 814 BGB scheide aus, da die Beklagte eine positive Kenntnis der Klägerin von dem Nichtbestehen einer Zahlungspflicht nicht nachgewiesen habe.
Schließlich liege in der Zahlung der Klägerin auch kein deklaratorisches Schuldanerkenntnis, das einen Rückforderungsanspruch ausschließen könnte.
Gegen das ihr am 21.12.2020 zugestellte Urteil wendet sich die Beklagte mit der am 30.12.2020 eingegangenen Berufung, die innerhalb verlängerter Berufungsbegründungsfrist am 18.03.2021 begründet worden ist.
Die Beklagte rügt, das Landgericht habe zu Unrecht das Vorliegen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zwischen Herrn T. und der Zeugin L. angenommen.
Das Landgericht habe bei seiner Beurteilung nicht ausreichend berücksichtigt, dass Herr T. und die Zeugin L. über kein gemeinsames Konto verfügt hätten und keine gemeinsame steuerliche Veranlagung stattgefunden habe. Auch die Tatsachen, dass Herr T. die Zeugin L. weder im Rahmen eines Testaments als Erbin eingesetzt habe, noch sie in sonstiger Weise wirtschaftlich über seinen Tod hinaus abgesichert habe, sprächen deutlich gegen die Annahme einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft.
Auch der Umstand, ein gemeinsames Kind zu haben, genüge noch nicht, eine nichteheliche Lebensgemeinschaft anzunehmen. Insoweit habe das Landgericht nicht ausreichend gewürdigt, dass C. T. mit Blick auf das Scheidungsurteil vom 15.04.2010 zeitlich noch innerhalb der nach § 1592 Nr. 1 BGB zugunsten des Herrn L., dem früheren Ehemann der Zeugin L., geltenden Vaterschaftsvermutung geboren worden sei. Auch sei der Behauptung der Beklagten, dass Herr T. nicht der biologische Vater der C. T. gewesen sei, vom Landgericht verfahrensfehlerhaft nicht nachgegangen worden, obwohl die Zeugin L. erst drei Monate vor der Geburt aus Thailand zurückgekommen sei, das Kind also in Thailand gezeugt worden sein müsse.
Auch die Tatsache, dass Einkommen gemeinsam für die Ausgaben des Haushalts verwendet worden seien, genüge nicht für die Annahme einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft.
Das Landgericht habe auch nicht ausreichend die Höhe des Einkommens der Zeugin L. sowie deren genaue Quelle aufgeklärt. Die Angaben der Zeugin L. seien insoweit widersprüchlich gewesen, so habe sie zum einen angegeben, zusammen mit Herrn T. zuerst in E. und dann in B. ein Massage-Studio betrieben zu haben, dann habe sie wieder angegeben, bei Herrn T. angestellt gewesen zu sein. Die unstreitig erfolgte sozialversicherungspflichtige Tätigkeit der Zeugin L. bei den Firmen des Herrn T., also bei der M. Service GmbH im Zeitraum von 2014 bis 2016 und bei der M. Express GmbH im Zeitraum ab 2016, weise die Unrichtigkeit der Angaben der Zeugin L. nachdrücklich auf.
Das Landgericht habe auch nicht näher aufgeklärt, welche Schulden des Herrn T. die Beiden laut der Zeugin L. gemeinsam mit ihrem jeweiligen Einkommen zurückgeführt haben wollen.
Schließlich stehe die zum Unfallzeitpunkt weiter bestehende Ehe des Herrn T. mit der Zeugin T. der Annahme einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft entgegen. Herr T. habe bis zu seinem Tod mit der Zeugin T. weiterhin bewusst eine wirtschaftliche Gemeinschaft gebildet. Die Zeugin T. habe von ihm eine Generalvollmacht erhalten und nach seinem Tod die gesamte Liquidation durchgeführt. Die gemeinsamen Firmen und Häuser hätten den Lebensunterhalt des Herrn T., der Zeugin T. sowie ihrer gemeinsamen Kinder und Enkel sichern sollen, weshalb Herr T. auch kein Testament zugunsten der Zeugin L. errichtet habe. Herr T. habe auch noch mit der Zeugin T. im Hausanwesen X 24 in B. zusammen gewohnt; auch seine private Post und die Post für die Firma M. Express GmbH seien an diese Anschrift gegangen, was die Briefkastenschilder dokumentieren würden.
Die Beklagte beantragt:
Unter Abänderung des am 10.12.2020 verkündeten Urteils des Landgerichts Konstanz, Az. E 2 O 127/18, wird das Urteil wie folgt neu gefasst:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Auf die Widerklage hin wird festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten sämtliche weiteren über die bisherigen Zahlungen hinausgehenden Schäden zu ersetzen, die der Beklagten aus dem Schadensereignis vom 16.09.2016 gegen 15.45 Uhr auf dem Anwesen Y 2, B., OT M., durch die Verletzung der Frau L., Y 2, B., entstanden sind und noch entstehen werden.
Die Klägerin beantragt: Die Berufung wird zurückgewiesen.
Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens.
Die mit den Berufungsangriffen vorgetragenen Erwägungen der Beklagten seien unzutreffend. Die Würdigung der Angaben der Zeuginnen T. und L. durch das Landgericht sei nicht zu beanstanden. Anhand deren glaubhafter Angaben und weiterer Indizien sei das Landgericht zutreffend zu der Annahme gelangt, dass zwischen Herrn T. und der Zeugin L. im Unfallzeitpunkt sowohl eine nichteheliche Lebensgemeinschaft als auch eine häusliche Gemeinschaft bestanden habe.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
II.
Die Berufung ist zulässig, jedoch unbegründet.
Das Landgericht ist zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Klage begründet ist, die Widerklage dagegen unbegründet.
A.
Die Klage ist in der vom Landgericht ausgesprochenen Form begründet. Der Klägerin kann von der Beklagten gemäß § 812 Abs. 1 S. 1, Alt. 1 BGB die Rückzahlung von 71.208,97 € verlangen, da sie diese Leistung an die Beklagte ohne Rechtsgrund erbrachte.
1.
Eine Leistung der Klägerin an die Beklagte liegt vor.
Die Klägerin zahlte auf das Anforderungsschreiben der Beklagten vom 03.01.2017, mit dem diese die Erstattung von in Zusammenhang mit dem Unfall der Zeugin L. erbrachten Sozialversicherungsleistungen in Höhe von 71.208,97 € geltend machte, den darin geforderten Betrag an die Beklagte.
2.
Die Leistung erfolgte ohne Rechtsgrund, da eine Forderung der Beklagten gegenüber der Klägerin nicht bestand.
Die Beklagte ist nach § 116 Abs. 1 SGB X a.F. nicht Inhaberin von Schadensersatzansprüchen der Zeugin L. geworden, da nach den analog anzuwendenden Grundsätzen des § 116 Abs. 6 SGB X a.F. ein gesetzlicher Forderungsübergang nicht stattgefunden hat.
a)
Nach § 120 Abs. 1 Satz 3 SGB X ist für das vorliegende Unfallereignis die Fassung des § 116 Abs. 6 SGB X anzuwenden, die bis zum 31.12.2020 gegolten hat (im Folgenden a.F.).
Nach dessen Wortlaut ist ein Anspruchsübergang bei einer nicht vorsätzlichen Schädigung dann ausgeschlossen, wenn die Schädigung durch einen Familienangehörigen erfolgt ist, der im Zeitpunkt des Schadensereignisses mit dem Geschädigten oder seinen Hinterbliebenen in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat.
Nach ständiger Rechtsprechung ist das Haftungsprivileg zumindest in einer analogen Anwendung über den Wortlaut hinaus aber auch auf den Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft anzuwenden. Die Vergleichbarkeit der Schutzwürdigkeit erfordert im Bereich des Sozialversicherungsrechts ebenso wie im Versicherungsvertragsrecht, das insoweit durch die Neufassung des § 86 Abs. 3 VVG bereits zum 01.01.2008 eine entsprechende Erweiterung erfuhr, zumindest eine analoge Anwendung des Haftungsprivilegs. Ein unterschiedliches Verständnis des Angehörigenprivilegs im Bereich des Versicherungsvertragsrechts einerseits und des Sozialversicherungsrechts andererseits ist weder geboten noch gerechtfertigt (vgl. BGH, Urteil vom 05. Februar 2013 - VI ZR 274/12 -, BGHZ 196, 122-130, juris Rn. 18 ff.).
b)
Vorliegend scheidet ein gesetzlicher Übergang von Schadensersatzansprüchen der Zeugin L. auf die Beklagte nach der analogen Anwendung der Grundsätze des § 116 Abs. 1 SGB X a.F. aus, weil nach den zugrundeliegenden Feststellungen Herr T. und die Zeugin L. zum Unfallzeitpunkt als nichteheliche Lebensgemeinschaft zusammen in einer häuslichen Gemeinschaft lebten und der Unfall von Herrn T. nicht vorsätzlich herbeigeführt wurde.
aa) Nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO ist das Berufungsgericht grundsätzlich an die Tatsachenfeststellungen des ersten Rechtszuges gebunden. Diese Bindung entfällt nur, wenn konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit entscheidungserheblicher Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 Halbs. 2 ZPO). Konkrete Anhaltspunkte in diesem Sinne sind alle objektivierbaren rechtlichen oder tatsächlichen Einwände gegen die erstinstanzlichen Feststellungen. Derartige konkrete Anhaltspunkte können sich unter anderem aus dem Vortrag der Parteien, vorbehaltlich der Anwendung von Präklusionsvorschriften auch aus dem Vortrag der Parteien in der Berufungsinstanz ergeben. Zweifel im Sinne von § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO liegen schon dann vor, wenn aus der für das Berufungsgericht gebotenen Sicht eine gewisse - nicht notwendig überwiegende - Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass im Fall der Beweiserhebung die erstinstanzliche Feststellung keinen Bestand haben wird, sich also deren Unrichtigkeit herausstellt (vgl. BGH, Beschluss vom 21. März 2018 - VII ZR 170/17 -, juris Rn. 15; BGH, Beschluss vom 04. September 2019 - VII ZR 69/17 -, juris Rn. 11). Bei der Berufungsinstanz handelt es sich daher um eine zweite - wenn auch eingeschränkte - Tatsacheninstanz, deren Aufgabe in der Gewinnung einer fehlerfreien und überzeugenden und damit richtigen Entscheidung des Einzelfalls besteht (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juni 2016 - VIII ZR 191/15 -, juris; BGH, Beschluss vom 04. September 2019 - VII ZR 69/17 -, juris Rn. 11 ff.). Daher hat das Berufungsgericht die erstinstanzliche Überzeugungsbildung nicht nur auf Rechtsfehler zu überprüfen (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Oktober 2016 - VIII ZR 300/15 -, juris; BGH, Beschluss vom 04. September 2019 - VII ZR 69/17 -, juris Rn. 11 ff.).
bb) Soweit das Landgericht im Zusammenhang mit dem Unfall das Vorliegen von Anknüpfungstatsachen einer vorsätzlichen Schädigungshandlung des Herrn T. verneint hat, werden von der Beklagten insoweit keine Zweifel an der Vollständigkeit und Richtigkeit aufgezeigt. Im Gegenteil wird von der Beklagten eine Unrichtigkeit dieser tatsächlichen Feststellungen im Rahmen ihrer Berufungsbegründung gar nicht gerügt.
Es ergeben sich auch im Übrigen keine Anhaltspunkte für eine unrichtige Feststellung. Selbst wenn Position und Laufrichtung der Zeugin L. bei dem Unfall im Detail anders gewesen wären als von Herrn T. geschildert, ergeben sich hieraus keine Anhaltspunkte für ein vorsätzliches Handeln des Herrn T..
cc) Anhand einer Gesamtschau der unstreitigen Tatsachen und der aufgrund der vom Landgericht durchgeführten Beweisaufnahme festgestellten Tatsachen ist davon auszugehen, dass Herr T. und die Zeugin L. im Zeitpunkt des Unfallgeschehens als nichteheliche Lebensgemeinschaft zusammen in einer häuslichen Gemeinschaft lebten.
(1) Eine nichteheliche Lebensgemeinschaft im Sinne einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft ist eine Lebensgemeinschaft, die auf Dauer angelegt ist, daneben keine weitere Lebensgemeinschaft gleicher Art zulässt und sich durch innere Bindungen auszeichnet, die ein gegenseitiges Einstehen der Partner füreinander begründen, also über die Beziehungen in einer reinen Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft hinausgehen. Als Hinweistatsachen, die sich nicht erschöpfend aufzählen lassen, für das Bestehen einer solchen Gemeinschaft kommen etwa in Betracht die lange Dauer des Zusammenlebens, die Versorgung von Kindern und Angehörigen im gemeinsamen Haushalt und die Befugnis, über Einkommen und Vermögensgegenstände des anderen Partners zu verfügen (vgl. BVerfG, Urteil vom 17. November 1992 - 1 BvL 8/87 -, juris Rn. 92 ff.).
(2) Vor dem Hintergrund dieser rechtlichen Maßstäbe ist in einer Gesamtschau sowohl der unstreitigen Tatsachen als auch der vom Landgericht aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme festgestellten Tatsachen das Vorliegen sowohl einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft als auch einer häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Unfallverursacher T. und der Zeugin L. zu bejahen.
Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass das Landgericht die entscheidungserheblichen Tatsachen unrichtig oder unvollständig festgestellt hat. Entgegen dem Berufungsvorbringen ist das Landgericht fehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt, aufgrund der Angaben der Zeuginnen L. und T. in einer Gesamtschau mit weiteren Indizien wie der Dauer des Zusammenlebens, dem gemeinsam geführten Haushalt mit Erziehung eines gemeinsamen Kindes, den konkreten Wohnverhältnissen und Lebensumständen sowie dem Verhalten nach dem Unfall das Bestehen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zwischen der Zeugin L. und dem verstorbenen Herrn T. zum Unfallzeitpunkt als bewiesen anzusehen.
Das Landgericht hat hierbei die Angaben der Zeuginnen sowie die weiteren objektiven Indizien überzeugend und widerspruchsfrei gewürdigt, die von der Beklagten hiergegen erhobenen Rügen gehen fehl.
Anhand der Angaben der Zeuginnen L. und T. ist das Landgericht zu Recht davon ausgegangen, dass Herr T. und die Zeugin L. im Zeitpunkt des Unfalls bereits über mehrere Jahre hinweg mit der gemeinsamen Tochter C. T. in einer häuslichen Gemeinschaft lebten, zuerst seit 2009 in einem gemeinsamen Haushalt in W. und später in dem Hausanwesen Y 2 in B.. Die Zeugin L. hat detailliert und nachvollziehbar anhand der unterschiedlichen Räume der Wohnung in B. die auf Dauer angelegte gemeinsame Nutzung der Wohnung dargelegt, so hat sie u.a. anhand der Nutzung der beiden Schlafzimmer und der übrigen Räume sowie des allgemeinen Tagesablaufs anschaulich und glaubhaft das alltägliche gemeinsame Leben einer Familie bestehend aus Vater, Mutter und Kind in einer gemeinsamen Wohnung geschildert. Diese Angaben der Zeugin L. sind von der Zeugin T. - soweit ihre Erkenntnismöglichkeiten gereicht haben - bestätigt worden. Sie hat so insbesondere darauf hingewiesen, dass sich Herr T. bei ihren wenigen jährlichen Besuchen in B. immer in der Wohnung in dem Hausanwesen Y 2 in B. zum Essen und Schlafen aufgehalten habe. Für die Richtigkeit der Gegenbehauptung der Beklagten, Herr T. habe im Unfallzeitpunkt nicht mit der Zeugin L., sondern in einem getrennten Haushalt gemeinsam mit der Zeugin T. im Hausanwesen X 24 in B. gelebt, haben sich dagegen gar keine Anhaltspunkte ergeben. Die Zeugin T. hat eindrücklich ihre dauerhafte Trennung „von Tisch und Bett“ mit Herrn T. im Jahr 2008 beschrieben, die sie durch ihren Umzug nach Österreich vollzogen habe, nachdem ihr Herr T. sein Verhältnis mit der Zeugin L. offengelegt habe. An dieser Trennung „von Tisch und Bett“ habe sich auch bis zum Tod des Herrn T. nichts verändert.
Soweit die Beklagte rügt, das Landgericht hätte eine Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft von Herrn T. und der Zeugin L. erst annehmen dürfen, wenn es die widersprüchlichen Angaben der Zeugin L. zu ihren Einkommens- und Beschäftigungsverhältnissen vollständig aufgeklärt hätte, ist darauf hinzuweisen, dass die von der Zeugin L. geäußerten Angaben, sie habe zusammen mit Herrn T. ein Massage-Studio betrieben, nicht im Widerspruch zu den unstreitig zeitlich nacheinander folgenden Anstellungsverhältnissen der Zeugin L. bei den beiden Firmen des Herrn T. steht. Es ist weder in einer Ehe noch in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ungewöhnlich, dass ein gemeinsames Geschäftsprojekt in der Weise umgesetzt wird, dass der eine Partner der Eigentümer und Geschäftsführer des Unternehmens ist und der andere Partner bei dem Unternehmen angestellt ist, um - wie vorliegend offenkundig geschehen - sozialversicherungsrechtlich abgesichert zu sein. Insoweit begründen auch die Ausführungen der Zeugin L., man habe nicht nur die Kosten des gemeinsamen Haushalts, sondern auch die Schulden des Herrn T. gemeinsam zurückgeführt, keine vernünftigen Zweifel an der generellen Glaubhaftigkeit ihrer Angaben, da bei einer solchen Geschäftskonstruktion sich der sozialversicherungsrechtlich angestellte Partnernatürlich in gleicher Weise mit dem gemeinsam gesteckten Ziel eines besseren wirtschaftlichen Fortkommens identifiziert wie der Partner, der als Anteilseigner und Geschäftsführer der jeweiligen Firma agiert.
Vor diesem Hintergrund hat das Landgericht zu Recht im Rahmen einer Gesamtbetrachtung aller Umstände das Zusammenleben des Herrn T. und der Zeugin L. dahingehend gewertet, dass es sich um eine Lebensgemeinschaft im Sinn einer Verantwortungsgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau handelte, die auf Dauer angelegt war, daneben keine weiteren Lebensgemeinschaften gleicher Art zuließ und sich durch Bindungen auszeichnete, die ein gegenseitiges Einstehen der Partner füreinander begründeten und explizit über die Beziehung in einer reinen Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft hinausging.
Diese Annahme gründet insbesondere auf dem oben bereits angeführten langjährigen Zusammenleben der beiden in einem gemeinschaftlich geführten Haushalt und der Erziehung des gemeinsamen Kindes C. T..
Soweit von der Beklagten die „biologische Vaterschaft“ des Herrn T. für die am 08.08.2009 geborene gemeinsame Tochter C. T. in Frage gestellt wird, stellt dies die Annahme einer Verantwortungsgemeinschaft von Herrn T. und der Zeugin L. gegenüber dem Kind nicht in Frage. Soweit Herr T. nach dem Inhalt des Auszugs aus dem Geburtseintrag Nr. G xxx des Standesamts der Stadt W. vom 29.11.2011 als Vater genannt wird, erbringt diese öffentliche Urkunde nach den Grundsätzen der §§ 415 Abs. 1, 418 Abs. 1 ZPO vollen Beweis über den beurkundeten Vorgang und die darin bezeugten Tatsachen, so dass die Vaterschaft des Herrn T. hierdurch als bewiesen anzusehen ist. Der bloße Hinweis der Beklagten auf den Aufenthalt der Zeugin L. in Thailand bis drei Monate vor der Geburt des Kindes in W. oder der Verweis auf die „Vaterschaftsvermutung“ des § 1592 Nr. 1 BGB genügen mit Blick auf die Regelungen des § 1592 Nr. 2 und Nr. 3 BGB insoweit nicht den Anforderungen der §§ 415 Abs. 2, 418 Abs. 2 ZPO. Weder wird von der Beklagten dargelegt, dass die Voraussetzungen für eine Vaterschaft des Herrn T. nach § 1592 Nr. 2 und Nr. 3 BGB nicht gegeben sind, noch wird ein entsprechendes Beweismittel zum Gegenbeweis angeführt. Das Bestreiten der biologischen Vaterschaft reicht insoweit jedenfalls nicht aus, da im Gegensatz zur Mutterschaft das Vorliegen einer Vaterschaft nach den Grundsätzen der § 1592 BGB auf rechtlichen Annahmen gründet und nicht auf der biologischen Zeugung des
Eine Verantwortungsgemeinschaft zwischen Herrn T. und der Zeugin L. ist auch nicht mit Blick auf die Tatsache, dass er die Zeugin L. nicht im Rahmen eines Testaments bedachte, in Frage zu stellen. Im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge sind gem. § 1924 BGB nämlich in erster Linie die Abkömmlinge des Herrn T. begünstigt, also auch die gemeinsame Tochter C. T., deren künftiges wirtschaftliches Fortkommen dadurch gesichert worden ist. Das für die Annahme einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sprechende Indiz einer Versorgung der gemeinsamen Kinder ist insoweit also gewahrt.
Soweit die Beklagte anführt, Herr T. habe keine Vorsorge für die Zeugin L. geschaffen, ist dem zu widersprechen. Nach dem unstreitigen Parteivortrag beschäftigte Herr T. die Zeugin L. in seinen Firmen als Mitarbeiterin, die Zeugin L. erhielt so über die gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherungen eine soziale Absicherung, was das vorliegende Verfahren augenscheinlich dokumentiert. Die weitere Tatsache, dass Herr T. es schaffte, dass die Zeugin L. mit ihm und dem gemeinsamen Kind in einem Haus leben konnte, das auch im Miteigentum seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau, der Zeugin T., stand, zeigt nachdrücklich auf, dass er sowohl für die Zeugin L. als auch für das gemeinsame Kind ein hohes Maß an Verantwortung zeigte.
Im Übrigen ist es nach der allgemeinen Lebensanschauung für eine nichtehelichen Lebensgemeinschaft auch nicht prägend, dass der eine Partner aus eigenen Mitteln für den anderen Partner eine gesicherte Altersvorsorge schafft. Grundsätzlich bleiben die Partner einer nichtehelichen Gemeinschaft in ihren wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten eigenständig und schaffen gerade keine umfassende Rechtsverbindlichkeit. Insoweit spricht auch die Tatsache, dass Herr T. und die Zeugin L. über keine gemeinsamen Konten verfügten, nicht gegen die Annahme einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft.
Die Tatsache, dass die Zeugin L. über den Mitbesitz und die Nutzung des Hausanwesens Y 2 in B. sowie die Mitarbeit als Angestellte in den jeweiligen Firmen des Herrn T. keine Befugnis erhielt, über die weiteren Vermögensgegenstände des Herrn T. zu verfügen, spricht insoweit ebenfalls nicht gegen die Annahme einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Unstreitig befanden sich die Hausanwesen und verschiedene Firmen im Miteigentum von Herrn T. und der Zeugin T., seiner getrennt lebenden Ehefrau; ein weitergehender Zugriff war - über die bereits beschriebenen Maßnahmen hinaus - weder sozialadäquat noch sinnvoll und ohne die rechtliche Mitwirkung der Zeugin T. wohl auch gar nicht möglich.
Auch die Tatsache, dass Herr T. und die Zeugin L. keine gemeinsame steuerliche Veranlagung vorgenommen haben, spricht nicht gegen die Annahme einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, da eine solche Zusammenveranlagung nach § 2 Abs. 8 EStG aktuell von den Finanzgerichten gar nicht zugelassen wird (vgl. BFH, Beschluss vom 26. April 2017 - III B 100/16 -, BFHE 257, 424, BStBl II 2017, 903).
Soweit die Beklagte anführt, dass die fortbestehende Ehe zwischen Herrn T. und der Zeugin T. die Annahme einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft generell ausschließe, ist dem zu widersprechen (vgl. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Beschluss vom 16. November 1995 - 6 S 3171/94 -, juris Rn. 15 ff.; Götz in Grüneberg; BGB, 82. Auflage 2023, Einf. v. § 1297 BGB Rn. 11). Eine fortdauernde Ehe würde nur dann die Annahme einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ausschließen, wenn sie nach den obigen Grundsätzen eine weitere Lebensgemeinschaft gleicher Art darstellen würde.
Dies ist vorliegend nicht der Fall. Wie oben bereits ausgeführt, hat die Zeugin T. glaubhaft und detailliert ihre dauerhafte Trennung „von Tisch und Bett“ im Jahr 2008 und ihren später folgenden Umzug nach Österreich beschrieben. Die Tatsache, dass sich die beiden Ehepartner nicht vermögensrechtlich auseinandergesetzt haben, spricht nicht gegen ein Getrenntleben i.S.v. § 1567 BGB. Im Hinblick auf die hohen Kosten eines Scheidungsverfahrens und die wirtschaftlichen Nachteile einer Auseinandersetzung der gemeinsamen Vermögenswerte im Rahmen eines Zugewinnausgleichs, vermeiden viele getrennt lebende Paare - wie im vorliegenden Fall - eine Scheidung und führen ein gemeinsam begründetes Geschäft bzw. verwalten das gemeinsame Immobilienvermögen einverständlich weiter. Vor diesem Hintergrund verwundert auch nicht die Tatsache, dass die Zeugin T. über eine Generalvollmacht des Herrn T. verfügte, um in dessen Krankheitsfall die notwendigen Maßnahmen zum Erhalt und Fortbestehen der gemeinsamen Vermögenswerte vornehmen zu können. Hierauf kann aber keinesfalls die Annahme einer fortbestehenden ehelichen Lebens- und Verantwortungsgemeinschaft aufgebaut werden. Ebenso wenig kann auf der von der Beklagten angeführten von Herrn T. und der Zeugin T. gewählten Gestaltung des geschäftlichen und privaten Postverkehrs eine solche Annahme aufgebaut werden.
Letztlich sprechen in einer Gesamtbetrachtung die angeführten Indizien eindeutig für die Annahme einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zwischen Herrn T. und der Zeugin L. im Zeitpunkt des Unfalls. Anhand der glaubhaften Angaben der Zeuginnen ist davon auszugehen, dass seit dem Jahr 2008 zwischen Herrn T. und der Zeugin L. eine geschlechtliche Beziehung bestand, die zur dauerhaften Trennung der ehelichen Gemeinschaft von Herrn T. mit der Zeugin T. führte. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter C. T. im Jahr 2009 begründeten beide eine dauerhafte nichteheliche Lebens- und Verantwortungsgemeinschaft und einen gemeinsamen Haushalt. Durch die Anstellung der Zeugin L. folgte eine Verknüpfung der wechselseitigen wirtschaftlichen und beruflichen Ambitionen und mit dem Zutun von Herrn T. eine ausreichende soziale Absicherung der Zeugin L.. Die von den Zeuginnen glaubhaft geschilderten Bemühungen von Herrn T., die nach dem Unfall bei der Zeugin L. eingetretenen gesundheitlichen Schäden durch viel Zuwendung wiedergutzumachen, runden dieses Bild insoweit nur weiter ab.
3.
Eine Anwendung von § 814 BGB scheidet mangels einer positiven Kenntnis der Klägerin vom Nichtbestehen der Schuld aus.
Soweit das Landgericht festgestellt hat, dass die Klägerin im Zeitpunkt der Zahlung keine positive Kenntnis über das Bestehen der nichtehelichen Lebensgemeinschaft hatte, werden von der Beklagten insoweit keine Zweifel an der Vollständigkeit und Richtigkeit der getroffenen Feststellungen aufgezeigt. Im Gegenteil wird von der Beklagten eine Unrichtigkeit dieser tatsächlichen Feststellungen im Rahmen ihrer Berufungsbegründung gar nicht gerügt.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil verwiesen. Es reicht vorliegend für die Annahme einer positiven Kenntnis jedenfalls nicht aus, dass der Klägerin im Verlauf der Schadensbearbeitung Unterlagen zugingen, aus denen sich Anhaltspunkte für das Vorliegen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ergaben, ohne dass diese Information bewusst zur Kenntnis genommen und ein entsprechender Schluss gezogen wurde.
4.
Die Klägerin hat durch die Zahlung des von der Beklagten geltend gemachten Betrages auch kein deklaratorisches Schuldanerkenntnis abgegeben, was einer Rückzahlung entgegenstehen würde. Es wird insoweit auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil verwiesen.
5.
Der Zahlungsanspruch ist nach den §§ 286, 288 Abs. 1 BGB mit dem gesetzlichen Satz zu verzinsen.
Die Beklagte ist mit der Zahlung in Verzug geraten. Mit Schreiben vorn 29.08.2017 forderte die Klägerin die Beklagte unter Fristsetzung bis 30.09.2017 unmissverständlich auf, den Betrag von 71.208,97 € zurückzuzahlen, so dass der Betrag ab dem 01.10.2017 zu verzinsen ist.
6.
Der Klägerin steht nach § 286 BGB auch der Ersatz der vom Landgericht ausgesprochenen vorgerichtlichen Anwaltskosten zu.
Nachdem die Beklagte auf die mehrmaligen Leistungsaufforderungen der Klägerin unstreitig nicht geleistet hatte, durfte die Klägerin ihre Prozessbevollmächtigten mit der außergerichtlichen Durchsetzung ihrer Ansprüche beauftragen.
Die Höhe der zugesprochenen Rechtsanwaltsgebühren sowie ihre Verzinsung ab Rechtshängigkeit der Klage nach § 291 BGB sind nicht zu beanstanden. Es wird insoweit auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil Bezug genommen.
B.
Die Widerklage ist unbegründet. Die Beklagte ist - wie oben ausgeführt - nicht nach § 116 Abs. 1 SGB X a.F. Inhaberin von Schadensersatzansprüchen der Zeugin L. geworden, da nach den analog anzuwendenden Grundsätzen des § 116 Abs. 6 SGB X a.F. ein gesetzlicher Forderungsübergang insoweit ausscheidet. Die Beklagte hat deshalb keinen Anspruch auf den von ihr verfolgten Feststellungsausspruch.
C.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 97 Abs. 1 ZPO.
Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat seine Grundlage in §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.
Im Regress der Krankenkasse nach § 116 SGB X muss eine schlüssig vorgetragene Forderung vorprozessual nicht belegt werden - Landgericht Stuttgart, Beschluss vom 30. Juni 2023 – 18 O 412/20, juris
Tenor
- Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz aus 60.692,30 € seit dem 22.12.2016 zu zahlen.
- Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Streitwert: 60.692,30 €.
Tatbestand
Die Klägerin macht mit der Klage auf sie gem. § 116 SGB X übergegangene Ansprüche von ... geltend. Dieser wurde bei einem Unfall am 14.11.2019 verletzt. Die Haftung des Unfallverursachers gegenüber Herrn ... zu 100 % ist unstreitig. Das Fahrzeug war im Unfallzeitpunkt bei der Beklagten haftpflichtversichert.
Die Beklagte hat zunächst die unfallbedingten Beeinträchtigungen und Verletzungen bestritten und dabei u.a. ausgeführt:
Selbst für Sekundärschäden, für die der Beweismaßstab gem. § 287 ZPO gelte, müsse die überwiegende Wahrscheinlichkeit bewiesen werden.
Des Weiteren hat die Beklagte geltend gemacht, dass ihr keine ausreichenden Unterlagen vorliegen würden, um die Notwendigkeit der Heilbehandlung überprüfen zu können.
Vorprozessual hat die Klägerin einen Anspruch in Höhe von 124.489,81 € geltend gemacht. Die Beklagte zahlte hierauf lediglich 63.797,51 €. Die Beklagte wurde mit Schreiben vom 19.12.2019 zur Zahlung gemahnt. Mit Schreiben vom 20.12.19 hat die Beklagte die Leistung abgelehnt.
Die Beklagte schrieb in einem Schreiben vom 13.08.2019:
„Senden Sie uns bitte - unverbindlich, da die Haftung noch nicht geklärt ist - folgende Unterlagen zu:
- Belege und Verordnungen
- Auszug DRG-Grupa.“
Die Klägerin antwortete mit Schreiben vom 07.10.2019 wie folgt:
„Als Anlage erhalten Sie alle uns vorliegenden Unterlagen einschließlich DRG, Belege und Verordnungen zu Ihrer internen Verwendung.“
Die Beklagte hat nach Prüfung der Unterlagen wie dargelegt, den Betrag von 63.797,15 € erstattet, entsprechend eines Prüfberichtes, der weitere Unterlagen anfordert.
Das Gericht hat darüber Beweis Beweis erhoben, ob Herr ... eine Gehirnblutung, Frakturen beider Beine, Fraktur des linken Arms, Prellungen erlitten habe, so dass die Behandlungen, die in den Anlagen zur Klageschrift von der Klägerin mit insgesamt 124.489,91 € in Rechnung gestellt wurden, ursächlich auf den Verkehrsunfall zurückzuführen sind. Im Rahmen einer verlängerten Frist zur Stellungnahme auf das Gutachten hat die Beklagte die Hauptforderung sodann anerkannt, so dass am 27.04.23 ein Teil-Anerkenntnisurteil erging.
Die Klägerin ist der Auffassung, es liege kein sofortiges Anerkenntnis vor und der Verzug sei im Jahr 2019 eingetreten.
Die Klägerin beantragt, wie tenoriert.
Die Beklagte beantragt, die weitergehende Klage abzuweisen.
Die Beklagte ist der Auffassung, es liege ein sofortiges Anerkenntnis vor, da ihr erst im April 2023 die erforderlichen Unterlagen zur Überprüfung der Berechtigung der Forderungen vorgelegen hätten.
Hinsichtlich des weiteren Parteivorbringens wird verwiesen auf sämtliche Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen.
Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens. Insofern wird Bezug genommen auf das Gutachten vom 14.02.23 (…).
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage hat auch bezüglich der Verzugszinsen Erfolg.
Dem Grunde nach kann die Klägerin von der Beklagten Ersatz der unfallbedingten Schäden gem. §§ 7, 17, 18 StVG, § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. § 115 VVG und 116 SGB V beanspruchen.
Die Hauptforderung war, was durch das Teilanerkenntnis unstreitig geworden ist, und durch das überzeugende und nachvollziehbare Gutachten zur Überzeugung des Gerichts feststeht, § 286 ZPO, berechtigt. Die Beklagte befand sich auch in Verzug, so dass die Klägerin Verzugszinsen, §§ 280 Abs. 2, 286, 288 BGB zustehen.
Ein etwaiges Nichtvertretenmüssen im Rahmen des Verzuges müsste die Beklagte darlegen und beweisen. Der Beklagten wurden ausreichend Unterlagen zur Überprüfung des Anspruchs vorgelegt. Die Klägerin hat ihr sämtliche vorliegenden Informationen zukommen lassen.
Die Beklagte hat es insofern selbst in der Klageerwiderung zutreffend auf den Punkt gebracht:
„Tabellarische Übersichten mögen für Zahlungen der Klägerin ausreichend sein, beweisen jedoch nicht einen übergegangenen Schadensersatzanspruch.“
Somit hat die Beklagte selbst ausgeführt, dass die Übersichten für die Nachvollziehbarkeit der Zahlungen ausreichend und hinreichend sind. Hinzu kommt, dass dies die Unterlagen waren, die die Beklagte in ihrem aller ersten Schreiben angefordert hatte. Dagegen überspannt die Beklagte die Anforderungen an die vorprozessualen Pflichten zur Vorlage von Unterlagen dahingehend, dass diese den Anspruch - wohl für die Beklagte - auch beweisen müssten. Des Weiteren hat die Beklagte auch nicht einmal im Ansatz irgendetwas dahingehend vorgetragen, dass bei dem auf den Unfall folgenden Krankenhausbesuchen beim Geschädigten eine andere Erkrankung festgestellt wurde, die sozusagen bei der Gelegenheit mitbehandelt wurde. Wäre dies der Fall gewesen, so hätte sich sicher auch aus dem der Beklagten übersandten Unterlagen ergeben. Des Weiteren verkennt die Beklagte rechtlich im Ansatz, dass soweit unfallbedingte Verletzungen behandelt werden, die behandelnden Personen grundsätzlich Erfüllungsgehilfen des Schädigers sind und eine Anspruchskürzung lediglich dann in Betracht kommt, wenn der Geschädigte die erfolgten Maßnahmen als aussichtslos ansehen durfte.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. Bereits entsprechend der gemachten Ausführungen, dass sich die Beklagte in Verzug befand, scheidet ein sofortiges Anerkenntnis gem. § 93 ZPO aus. Des Weiteren hat Veranlassung zur Klage gegeben, dessen Verhalten vor Prozessbeginn ohne Rücksicht auf Verschulden und materielle Rechtslage dem Kläger bei objektiver Würdigung, zu der Annahme veranlasst hat, ohne Klage werde er nicht zu seinem Recht kommen. Davon ist auszugehen, wenn die Beklagte die Forderung ablehnt, obwohl die Forderung im vorgerichtlichen Schreiben geltend gemacht wurde, fällig und durchsetzbar ist, genau bezeichnet wurde und sämtliche Angaben für den Forderungsbestand enthält. Eine schlüssig vorgetragene Forderung muss vorprozessual nicht belegt werden (vgl. OLG Karlsruhe, 3 W 5/17). Auch lagen die Behandlungsunterlagen hier spätestens durch den Schriftsatz vom 11.08.22 vor, so dass ein Anerkenntnis im April 2023 ebenfalls nicht sofortig war. Die Auffassung der Beklagten liefe darauf hinaus, dass ein sofortiges Anerkenntnis möglich wäre, wenn der Anspruch unzweifelhaft nachgewiesen ist. Insofern ist offensichtlich, dass diese Rechtsposition nicht haltbar ist.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in § 709 ZPO. Der Gebührenstreitwert war gem. § 63 Abs. 2 GKG festzusetzen.
Rechtsprechungsänderung zu sog. Schockschäden (Anmerkung zu BGH, Urteil vom 06.12.2022 - VI ZR 168/21, in: jurisPraxisreport-Medizinrecht 5/2023, Anm. 2)
Autor
Wolfdietrich Prelinger, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht, Fachanwalt für Versicherungsrecht
Erscheinungsdatum
25.05.2023
Anmerkung zu
Anmerkung zu BGH, Urteil vom 06.12.2022 – VI ZR 168/21
Artikel in juris öffnen https://www.juris.de/r3/document/jpr-NLMZ000002023/part/S
Quelle
Fundstelle
jurisPR-MedizinR 5/2023, Anm. 2
Herausgeber
Möller und Partner – Kanzlei für Medizinrecht
Zitiervorschlag
Prelinger, jurisPR-MedizinR 5/2023, Anm. 2
Im Regress der Krankenkasse nach § 116 SGB X wird die Richtigkeit der Krankenhausabrechnung grundsätzlich nicht mehr überprüft - LG Magdeburg, Urteil vom 14. März 2023 - 2 O 1150/21 (veröffentlicht bei juris und beck-online)
LG Magdeburg, Urteil vom 14. März 2023 – 2 O 1150/21 –, juris
Tenor
1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin zu 1. einen Betrag in Höhe von 221.567,72 € nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz aus einem Betrag i.H.v. 204.073,10 € für den Zeitraum vom 24.04.2021 bis 24.05.2021 sowie aus 221.567,72 € seit dem 25.05.2021 zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin zu 1. sämtliche weiteren Schäden zu ersetzen, die der Klägerin zu 1. aus dem Schadensereignis des ..., vom 26.06.2020 gegen 7:55 Uhr an der Kreuzung der B. Straße/ W.-Straße in ... G. entstanden sind und noch entstehen werden.
3. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin zu 2. sämtliche weiteren Schäden zu ersetzen, die der Klägerin zu 2. aus dem Schadensereignis des ..., vom 26.06.2020 gegen 7:55 Uhr an der Kreuzung der B. Straße/W.-Straße in ... G. entstehen werden.
4. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin zu 1.3449,81 € nebst Zinsen hieraus i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 23.09.2021 zu zahlen.
5. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
6. Die Kosten des Verfahrens tragen die Beklagten als Gesamtschuldner.
7. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Streitwert: Stufe bis 440.000,- €
Tatbestand
Die Klägerin zu 1. nimmt die Beklagte aus übergegangenem Recht (§ 116 SGB X) auf Ersatz stationärer Krankenhaus- und Heilbehandlungskosten und weiterer Kosten wie Krankengeld, Transportkosten, Kosten für Hilfsmittel und einer stationären Rehabilitationsbehandlung in Anspruch, die sie für ihren Versicherungsnehmer ... (folgend Geschädigter) aufgewandt hat. Zudem begehren die Klägerin zu 1. und die Klägerin zu 2. die Feststellung, dass die Beklagten als Gesamtschuldner darüber hinaus verpflichtet sind, weitere Schäden zu ersetzen, die durch das nachfolgend geschilderte Schadensereignis entstanden sind und noch entstehen werden.
Am 26.06.2020 gegen 7:55 Uhr befuhr ... mit seinem Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen ... die bevorrechtigte B. Straße in 3. G.. An der Kreuzung W.-Straße kam aus der W.-Straße aus Sicht des Geschädigten von rechts der von dem Beklagten zu 1. geführte und gehaltene und bei der Beklagten zu 2. Kfz-haftpflichtversicherte Pkw vom Typ VW Tiguan mit dem amtlichen Kennzeichen .... Der Beklagte zu 1. wollte nach links abbiegen und hatte gegenüber dem Geschädigten das Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren) zu beachten, fuhr aber trotzdem unachtsam weiter, sodass es zur Kollision kam. Der Geschädigte flog über den linken Kotflügel des Pkw und stürzte auf die Straße, wo er schwerstverletzt liegen blieb. Der Beklagte zu 1. wurde vom Amtsgericht Bernburg wegen fahrlässiger Körperverletzung rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt.
Die Klägerin zu 1. hat die Beklagte zu 2. mit am Folgetag zugegangenem Schreiben vom 24.08.2020 (Bl. 21 ff. Bd. I d.A.) aufgefordert, die streitgegenständlichen Kosten für die Krankenhausbehandlung vom 26.06.2020 in der A. Klinik Aschersleben i.H.v. 1.438,74 € zu begleichen. Hierauf zahlte die Beklagte zu 2. 1.428,74 €, also den abgerechneten Betrag abzüglich 10 € für behauptete ersparte Aufwendungen.
Die Klägerin zu 1. hat die Beklagte zu 2. fruchtlos mit am Folgetag zugegangenem Schreiben vom 05.10.2020 (Bl. 32 f. Bd. I d.A.) aufgefordert, einen Betrag i.H.v. 6.870,25 € zu begleichen. Hierbei handelt es sich um das Krankengeld für den Zeitraum 07.08.2020 bis 30.09.2020.
Die Klägerin zu 1. hat die Beklagte zu 2. fruchtlos mit am Folgetag zugegangenem Schreiben vom 13.11.2020 (Bl. 34 ff. Bd. I d.A.) aufgefordert, einen Betrag i.H.v. 8.808,07 € zu begleichen. Hierbei handelt es sich um Fahrtkosten vom 26.06.2020 (Unfalltransport ins Klinikum Aschersleben sowie Weitertransport ins BG-Klinikum B. in H.) sowie um das Krankengeld für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 26.10.2020. Beigefügt war der EDV-Beleg über das Krankengeld sowie das für die Berechnung des Krankengeldes gemäß § 47 SGB V maßgebliche in den letzten 3 vor Monaten vor dem Unfall gezahlte Gehalt.
Die Klägerin zu 1. hat die Beklagte zu 2. fruchtlos mit am Folgetag zugegangenem Schreiben vom 27.11.2020 (Bl. 38 ff. Bd. I d.A.) aufgefordert, einen Betrag i.H.v. 188.447,78 € zu begleichen. Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Krankenhausbehandlung des Geschädigten im Zeitraum vom 26.06.2020 bis 06.10.2020 im BG-Klinikum B. in H. von 188.727,78 € abzüglich der Zuzahlung von 280,00 €. Der Abrechnung wurden die Abrechnungsbelege des Krankenhauses, insbesondere der Datensatz nach § 301 SGB V, beigefügt. Mit Schreiben vom 28.12.2020 wurden diese Unterlagen nochmals sowie weitere Unterlagen überreicht.
Mit Schreiben vom 13.01.2021 (Bl. 56 Bd. I d.A.) bat der von der Beklagten zu 2. mit der Schadensregulierung beauftragte und bevollmächtigte Dienstleister A. um weitere Unterlagen, woraufhin die Klägerin mit Schreiben vom 01.04.2021 die Radiologiebefunde vom 13.08.2020, 11.09.2020 und 21.09.2020; die OP-Berichte vom 31.08.2020, 17.08.2020, 14.08.2020, 01.08.2020, 27.07.2020, 24.07.2020, 22.07.2020, 20.07.2020 und 19.07.2020; die Reha-Anträge vom 25.08.2020 und 08.09.2020; den Arztbericht vom 07.07.2020 sowie die Schwerstverletztendokumentation vom 26.06.2020 überreichte (Bl. 57-107 Bd. I).
Mit Schreiben vom 13.04.2021 (Bl. 108 Bd. I d.A.) forderte die A. GmbH weitere Unterlagen ab. Dieser Aufforderung kam die Klägerin zu 1. nicht nach.
Die Klägerin zu 1. mahnte die A. GmbH mit Schreiben vom 22.04.2021 (Bl. 109 f. Bd. I) und setzte eine Zahlungsfrist bezüglich aller Außenstände bis zum 06.05.2021. Zahlungen wurden daraufhin nicht geleistet.
Die Klägerin zu 1. hat die Beklagte zu 2. zudem fruchtlos mit am Folgetag zugegangenem Schreiben vom 22.04.2021 (Bl. 111 f. Bd. I d.A.) aufgefordert, Kosten i.H.v. 17.494,62 € zu begleichen. Hierbei handelt es sich um diverse Hilfsmittel, Fahrkosten, eine stationärer Reha-Frührehabilitation sowie um Krankengeld im Zeitraum vom 27.10.2020 bis 25.11.2020.
Die Klägerin zu 1. behauptet, dass der Geschädigte ... unter anderem folgende Verletzungen erlitten habe:
- Polytrauma
- anoxische Hirnschädigung
- Hirninfarkt
- Aszites
- Rektumverletzung
- Ileostoma
- Septischer Schock
- Querfortsatzfrakturen LWK 4/5
- Deckenplattenimpressionsfraktur BWK 2
- diffuser axonaler Schaden
- Fraktur des os sacrum
- Candida-Sepsis
- Rippenserienfraktur 4-10
- Pleuraerguss
- traumatischer Pneumothorax
- Spondylose
- Ulna- und Radiusfraktur
- Fraktur des os pubis
- Streptokokkenpneumonie
Die Klägerin zu 1. habe daher aufgrund des Vorfalls bzw. des dadurch entstandenen Gesundheitsschadens des Geschädigten Leistungen i.H.v. 221.577,72 € erbracht.
Sie ist der Auffassung, dass keine Pflicht bestehe, den Beklagten bzw. der von der Beklagten zu 2. beauftragten A. GmbH weitere Unterlagen aus der Patientenakte zum Krankenhausaufenthalt vom 26.06.2020 bis 06.10.2020 zukommen zu lassen.
Die Klägerinnen beantragen zu erkennen:
1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin zu 1. 221.577,72 € nebst Zinsen hieraus i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. seit dem 24.04.2021 zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner darüber hinaus verpflichtet sind, der Klägerin zu 1. sämtliche weiteren Schäden zu ersetzen, die der Klägerin zu 1. aus dem Schadensereignis des ..., vom 26.06.2020 gegen 7:55 Uhr an der Kreuzung der B. Straße/ W.-Straße in ... G. entstanden sind und noch entstehen werden.
3. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin zu 1. 3.449,81 € vorgerichtliche Anwaltskosten ihres jetzigen Prozessbevollmächtigten nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen.
4. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner darüber hinaus verpflichtet sind, der Klägerin zu 2. sämtliche Schäden zu ersetzen, die der Klägerin zu 2. aus dem Schadensereignis des ... vom 26.06.2020 gegen 7:55 Uhr an der Kreuzung der B. Straße/ W.-Straße in ... G. entstehen.
Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen.
Die Beklagten erklären sich zu den von der Klägerin behaupteten Aufwendungen, zu der Höhe und dazu, dass die Klägerin den Betrag tatsächlich aufgewandt hat, die Leistung erbracht worden ist, sowie zu den den Aufwendungen zugrunde liegenden Verletzungsfolgen und den (vermeintlich) erforderlichen Behandlungsregimen sowie zu allen Umständen mit Nichtwissen, die weder eigene Handlungen noch eigene Wahrnehmungen der Beklagten betreffen und sind der Auffassung, dass dies ausreichend sei.
Sie behaupten, es fehle an der haftungsbegründenden und der haftungsausfüllenden Kausalität.
Sie sind zudem der Auffassung, dass es an der Fälligkeit fehle, weil der A. GmbH nicht die abgeforderten Unterlagen überreicht worden seien.
Die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft Magdeburg mit dem Az. ... ist zu Beweiszwecken beigezogen worden.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die eingereichten Schriftsätze und Anlagen sowie auf die Protokolle der öffentlichen Sitzungen vom 26.04.2022 und 31.01.2023 Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist überwiegend begründet.
I. Die Klägerin hat Anspruch auf Erstattung eines Betrages in Höhe von 221.567,72 €.
1. Die Beklagten haften für die materiellen Schäden aus dem Unfallereignis vom 26.06.2020 dem Grunde nach mit einer Haftungsquote von 100 %. Dies ergibt sich aus § 116 Abs. 1 SGB X i.V.m. §§ 7 Abs. 1, 11, 18 Abs. 1 StVG i.V.m. § 115 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VVG. Der Verkehrsunfall wurde durch ein vorwerfbares Verhalten des Beklagten zu 1) verursacht, so dass die Beklagten dem Grunde nach für entstandene Schäden haften. Ein mitwirkendes Verschulden nach §§ 9 StVG, 254 BGB des Geschädigten ... wird von den Beklagten schon nicht behauptet.
Durch das Unfallereignis am 26.06.2020 wurden Körper und Gesundheit des Geschädigten ... bei Betrieb des Kraftfahrzeugs des Beklagten zu 1. verletzt. Dieses Fahrzeug war bei der Beklagten zu 2. haftpflichtversichert.
Der Beklagte zu 1. hätte bei Beachtung der gebotenen Aufmerksamkeit den Unfall vermeiden können. Er hat gegen das Vorfahrtsgebot des § 8 StVO verstoßen.
Ein Fall höherer Gewalt im Sinne des § 7 Abs. 2 StVG nicht vor.
Auch die haftungsbegründende Kausalität liegt vor. Zur Überzeugung des Gerichts steht fest, dass der Betrieb des von dem Beklagten zu 1. gesteuerten Kraftfahrzeugs in einer Weise auf das geschützte Rechtsgut in Form des Körpers und der Gesundheit des Geschädigten ... eingewirkt hat, die nachteilige Folgen auslösen kann. Es ist nämlich unstreitig, dass der Beklagte zu 1. dem Geschädigten ... die Vorfahrt genommen hat und dieser durch das Unfallereignis verletzt wurde.
Die haftungsausfüllende Kausalität steht ebenfalls zur Überzeugung der Kammer fest. Die haftungsausfüllende Kausalität ist der Ursachenzusammenhang zwischen dem Haftungsgrund (Rechtsgutverletzung) und dem entstandenen Schaden (Grüneberg, BGB, 81. Aufl. 2022, Vorb v § 249, Rn. 24).
Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit im Sinne von § 287 ZPO ist festzustellen, dass die bei Herrn ... aufgetretenen Schäden in ihrer Gesamtheit bei diesem Unfall entstanden sind. Der Geschädigte wurde bei dem Unfallereignis schwer verletzt. Die diversen Verletzungen ergeben sich insbesondere aus der Krankenhausrechnung zur Behandlung im Zeitraum vom 26.06.2020 bis 06.10.2020 im BG-Klinikum B. in H.. Aus dieser Abrechnung ergeben sich auch die durchgeführten zahlreichen Prozeduren. Entsprechendes kann zudem den als Anl. K8 vorgelegten Radiologiebefunden vom 13.08.2020,11.09.2020 und 21.09.2020, den OP-Berichten vom 31.08.2020, 17.08.2020,14.08.2020, 01.08.2020, 27.07.2020, 24.07.2020, 22.07.2020, 20.07.2020 und 19.07.2020, den Reha-Anträgen vom 25.08.2020 und 08.09.2020 sowie insbesondere dem Arztbericht vom 07.10.2020 entnommen werden. Diese Unterlagen lagen auch bereits vorgerichtlich der von der Beklagten zu 2. eingeschalteten A. GmbH vor. Aus dem Arztbericht vom 07.10.2020 ergibt sich, dass die Aufnahme am 26.06.2020 erfolgte, nachdem der Geschädigte ... als Motorradfahrer einen Verkehrsunfall mit Polytrauma erlitten hat. Sodann heißt es, dass sich in der Primärdiagnostik vor allem eine traumatische Rektumperforation, eine Rippenserienfraktur rechts, ein Pneumothorax und Weichteilemphysem rechts, eine grob dislozierte Trümmerfraktur des Unterarm rechts, Querfortsatzfrakturen LWK 4/5 rechts und eine Deckenplattenimpressionsfraktur BWK 2 ergaben. In sämtlichen Unterlagen findet sich keinerlei Hinweis darauf, dass einer der Schäden nicht auf den Unfall zurückzuführen war.
Die Beklagten erklären sich zu allem pauschal mit Nichtwissen. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 26.04.2022 wurde auch darauf hingewiesen, dass ein solches Bestreiten nicht hinreichend ist. Im nachgelassenen Schriftsatz vom 07.06.2022 beschränken sich die Beklagten jedoch darauf weiterhin alles mit Nichtwissen zu bestreiten und zu begründen, warum sie dies für zulässig erachtet. Dabei verkennen sie jedoch, dass die Klägerin zu 1) bereits mit der Klageschrift entsprechenden Nachweise erbracht hat. Hinzu kommt, dass sie sich auch das Wissen der von ihr eingesetzten A. GmbH zurechnen lassen muss. Ein pauschales Bestreiten mit Nichtwissen ist aufgrund der vorliegenden Nachweise unsubstantiiert und der Vortrag der Klägerin zu 1. nach § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden zu werten.
2.
a) Die Klägerin zu 1. hat keinen Anspruch gegen die Beklagten auf Zahlung von 10,00 € aus der Rechnung zum Krankenhausaufenthalt am 26.06.2020 im A. Klinikum Aschersleben. Von den abgerechneten 1.438,74 € hat die Beklagte zu 2. bereits 1.428,74 € gezahlt. Die Klägerin muss sich ersparte Aufwendungen des Geschädigten anrechnen lassen. Ersparte Aufwendungen sind wegen ihres engen Zusammenhangs mit dem entstandenen Nachteil nach der Differenzhypothese grundsätzlich anzurechnen. Anzurechnen sind bei Krankenhaus-, Pflegeheim- oder Kuraufenthalt die ersparten häuslichen Verpflegungskosten von 5-10 € pro Tag und zwar auf die Heilbehandlungskosten (Grüneberg, BGB, 81. Aufl. 2022, Vorb v § 249, Rn. 93). Die Beklagte war daher berechtigt 10,00 € für ersparte Aufwendungen abzuziehen.
b) Die Klägerin zu 1. hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Zahlung von 6.817,25 € für gezahltes Krankengeld für den Zeitraum vom 07.08.2020-30.09.2020. Das für die Berechnung des Krankengeldes gemäß § 47 SGB V maßgebliche in den letzten drei Vormonaten vor dem Unfall gezahlte Gehalt von März 2020: 4.268,37 € brutto/ 2.622,35 € netto, April 2020: 4.003,03 € brutto/ 2.491,45 € netto, Mai 2020: 4.250,08 € brutto/2.613,42 € netto (Bl. 37 Bd. I) wurde der Beklagten mit am Folgetag zugegangenem Schreiben vom 13.11.2020 übermittelt. Substantiierte Einwendungen werden nicht geltend gemacht.
c) Die Klägerin zu 1. hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Zahlung von 8.808,07 € für Fahrkosten vom 26.06.2020 (Unfalltransport in das A. Klinikum Aschersleben sowie Weitertransport in das BG-Klinikum B. in H.) sowie gezahltem Krankengeld für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 26.10.2020. Mit Schriftsatz vom 10.04.2022 hat die Klägerin die entsprechenden Verordnungen einer Krankenbeförderung des Geschädigten ... sowie die Abrechnungen der R. Rechenzentrum f. H. GmbH vorgelegt. Es handelt sich hierbei um Sammelrechnungen, wobei sich aus den darüber hinaus überreichten Unterlagen die dem Geschädigten zugeordneten Einzelbeträge ergeben. Substantiierte Einwendungen werden nicht geltend gemacht.
d) Die Klägerin zu 1. hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Zahlung von 188.447,78 € für die stationäre Krankenhausbehandlung im Zeitraum vom 26.06.2020 bis 06.10.2020 im BG-Klinikum H. B.. Dabei wurde bereits die Zuzahlung des Geschädigten i.H.v. 280,00 € berücksichtigt.
Die Klägerin zu 1. war nicht gegenüber den Beklagten bzw. der von der Beklagten zu 2.eingeschalteten A. GmbH verpflichtet, weitere Behandlungsunterlagen beizubringen. Die bereits zur Verfügung gestellten Unterlagen waren ausreichend, um zu beurteilen, dass der Krankenhausaufenthalt auf dem Unfallereignis vom 26.06.2020 beruhte.
Die Rechnung des Krankenhauses ist hingegen im zivilrechtlichen Regress nicht mehr zu überprüfen. Das Krankenhaus hat gegenüber der Klägerin zu 1. als gesetzliche Krankenversicherung des Geschädigten abgerechnet. Die Klägerin zu 1. selbst hatte bei Zweifeln an der sachlich-rechnerischen Richtigkeit die Möglichkeit gemäß § 275 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB V eine gutachterliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes (MD) einzuholen. Dabei ist zu beachten, dass sie diese Entscheidung lediglich anhand der ihr übermittelten Daten nach § 301 SGB V zu treffen hat. Nur der MD ist im Falle der Abrechnungsprüfung nach § 276 Abs. 2 S. 1 HS 2 SGB V ermächtigt, die erforderlichen Sozialdaten bei dem Krankenhaus anzufordern. Die Krankenkasse selbst hat kein Einsichtsrechts in die Behandlungsunterlagen. Zu berücksichtigen ist zudem, dass seit dem 01.01.2020 die Rechnungsprüfung durch die Krankenkassen stark eingeschränkt wurde. Seitdem ist es Krankenkassen gemäß § 275c Abs. 2 SGB V in der Fassung ab dem 01.01.2020 nur noch möglich, Rechnungen im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Prüfquoten zu überprüfen. Korrespondierend wurde in § 17c Abs. 2 a) S. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) geregelt, dass nach Übermittlung der Abrechnung an die Krankenkasse eine Korrektur ausgeschlossen ist, es sei denn, dass die Korrektur zur Umsetzung eines Prüfergebnisses des MDK oder eines rechtskräftigen Urteils erforderlich ist. Nach Abschluss einer Prüfung nach § 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB V erfolgen gemäß § 17c Abs. 2a) S. 2 KHG keine weiteren Prüfungen der Krankenhausabrechnung durch die Krankenkasse oder den Medizinischen Dienst. Gemäß § 17c Abs. 2 b) S. 1 KHG findet eine gerichtliche Überprüfung einer Krankenhausabrechnung über die Versorgung von Patientinnen und Patienten zudem nur statt, wenn vor der Klageerhebung die Rechtmäßigkeit der Abrechnung einzelfallbezogen zwischen Krankenkasse und Krankenhaus erörtert worden ist, wobei die Krankenkasse und das Krankenhaus eine bestehende Ungewissheit über die Rechtmäßigkeit der Abrechnung durch Abschluss eines einzelfallbezogenen Vergleichsbetrages beseitigen können (§ 17c Abs. 2 b) S. 2 KHG). Einwendungen und Tatsachenvortrag in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Krankenhausabrechnung können im gerichtlichen Verfahren nicht geltend gemacht werden, wenn sie im Rahmen der Erörterung nach Satz 1 nicht oder nicht innerhalb der in der Verfahrensregelung nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 vorgesehenen Frist, deren Lauf frühestens mit dem Inkrafttreten der Verfahrensregelung beginnt, schriftlich oder elektronisch gegenüber der anderen Partei geltend gemacht worden sind, und die nicht fristgemäße Geltendmachung auf von der Krankenkasse oder vom Krankenhaus zu vertretenden Gründen beruht (§ 17c Abs. 2 b) S. 3 KHG).
Die Abrechnung kann insoweit nicht mehr nachgelagerten Regress zwischen Krankenkasse und Schädiger angegriffen werden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn keine offensichtlichen Abrechnungsfehler vorliegen, denen die klagende Krankenkasse nicht nachgegangen ist. Anhaltspunkte für offensichtliche Abrechnungsfehler sind nicht ersichtlich und insbesondere auch von den Beklagten nicht vorgetragen.
Sofern man den Beklagten ein umfassendes Prüfungsrecht für die Krankenhausrechnung zugestehen würde und diese im Rahmen der Prüfung eine Rechnungskorrektur geltend machen würden, würde dies dazu führen, dass im hiesigen Verfahren die Krankenhausabrechnung umfassend zu überprüfen wäre. Im Falle der Rechnungskürzung könnte die Krankenkasse jedoch nicht mehr vom Krankenhaus die Korrektur der Abrechnung verlangen und die Kosten würden bei ihr und damit der Versichertengemeinschaft, deren Gelder die Krankenkasse verwaltet, verbleiben. Es ist jedoch nicht einzusehen, weshalb das Risiko einer nicht offensichtlich unzutreffend abgerechneten Krankenhausbehandlung von der Klägerin/ dem Geschädigten zu tragen ist.
Die A. GmbH hatte von der Klägerin zu 1. u.a. bereits folgende Unterlagen erhalten: die Radiologiebefunde vom 13.08.2020, 11.09.2020 und 21.09.2020; die OP-Berichte vom 31.08.2020, 17.08.2020, 14.08.2020, 01.08.2020, 27.07.2020, 24.07.2020, 22.07.2020, 20.07.2020 und 19.07.2020; die Reha-Anträge vom 25.08.2020 und 08.09.2020; den Arztbericht vom 07.07.2020 sowie die Schwerstverletztendokumentation vom 26.06.2020.
Sie forderte darüber hinaus das Beratungsprotokoll, die TISS/SAPS-Dokumentation, die Intensivkurve, Transfusionsprotokolle, die Fieberkurve (Normalstation) sowie ärztliche und pflegerische Dokumentation. Auch wenn konkrete Unterlagen abgefordert wurden, dürfte dies nahezu die gesamte Patientenakte sein. Die Anforderung zielt auf eine Abrechnungsprüfung ab und diente nicht mehr der Überprüfung, ob die Krankenhausbehandlung des Geschädigten im Hinblick auf das Unfallereignis am 26.06.2020 erfolgte. Das war bereits anhand der vorliegenden Unterlagen beurteilbar. Jedenfalls wurden keine substantiierten Einwendungen unter Berücksichtigung dieser Unterlagen erhoben. Im Schriftsatz der Beklagten vom 07.06.2022, Seite 4 f. wird eine Abrechnungsprüfung auch eingeräumt, in dem u.a. darauf abgestellt wird, dass für die DRG A11A mindestens 96 Behandlungsstunden, mindestens 1656 intensivmedizinische Punkte und bestimmte Prozeduren erforderlich seien.
Auch aus § 294 a SGB V ergibt sich nichts anderes. Dort wird von „erforderlichen Daten“ gesprochen. Dabei muss es sich nicht zwingend um sämtliche Behandlungsunterlagen handeln, sondern nur um solche, die eben erforderlich sind, um zu überprüfen, ob beispielsweise drittverursachte Gesundheitsschäden vorliegen.
Der Hinweis auf das BGH-Urteil vom 23.06.2020, Az. VI ZR 435/19 führt ebenfalls zu keiner anderen Beurteilung. Zwar hat der BGH in seinem Urteil vom 23.06.2020, Az. VI ZR 435/19, unter Rn. 10 (juris) entschieden, dass keine anderen Grundsätze gelten, als wenn die Zeugin ihren Schadensersatz selbst geltend machen würde. Diese Ausführungen beziehen sich jedoch auf den Forderungsübergang gemäß § 6 EFZG. Konkret wurde festgestellt, dass der Arbeitgeber außer der Entgeltfortzahlung auch darzulegen und zu beweisen hat, dass der Zeugin gegen die Beklagte ein Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfallschadens aus § 823 Abs. 1 BGB oder § 7 Abs. 1, § 11 S. 1 StVG i.V.m. § 115 Abs. 1 VVG zusteht. Streitgegenständlich war insbesondere, ob sich die Zeugin bei dem Unfall überhaupt eine entsprechende Verletzung zugezogen hat. Dass sich der Geschädigte im vorliegenden Verfahren schwer verletzt hat, steht jedoch fest. Zur Problematik der Überprüfung einer Krankenhausrechnung in ihrer Gesamtheit, wie sie sonst den Sozialgerichten vorbehalten ist, macht der BGH in dem o.g. Urteil keinerlei Ausführungen.
Insbesondere darf nicht verkannt werden, dass die Klägerin zu 1. gerade nicht nur eine selbst gefertigte Kostenaufstellung vorgelegt, sondern konkrete Abrechnungsunterlagen. Eine Auseinandersetzung mit diesen Unterlagen fand durch die Beklagten jedoch nicht und schon gar nicht in substantiierter Form statt.
Soweit die Beklagte zu 1. die Auffassung vertritt, es fehle an der Fälligkeit, geht dies fehl. Die Erteilung oder das Vorliegen einer Rechnung ist grundsätzlich keine Fälligkeitsvoraussetzung, auch dann nicht, wenn der Schuldner nach der Verkehrssitte einen Anspruch auf eine spezifizierte Abrechnung hat (Thüringer Oberlandesgericht, Urteil vom 15.05.2012, Az. 4 U 661/11, Rn. 57, juris). Beim Schadensersatzanspruch, auch bei einem übergegangenen, liegt die Rechnungserteilung als Fälligkeitsvoraussetzung dogmatisch fern (Thüringer Oberlandesgericht, Urteil vom 15.05.2012, Az. 4 U 661/11, Rn. 58, juris). Auch die unterbliebene Zusendung der weiteren Dokumentation führt nicht dazu, dass die Fälligkeit nachträglich entfällt.
e) Die Klägerin zu 1. hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Zahlung von 17.494,62 € für gezahlte Hilfsmittel (Prothesen/ Schienen i.H.v. 146,06 €, Toilettenhilfen i.H.v. 48,26 €, Adaptionshilfen i.H.v. 25,24 €, Stomaartikel i.H.v. 233,70 €), Fahrkosten (148,70 €), Kosten für die stationäre Rehabilitationsbehandlung – Frührehabilitation im Zeitraum vom 07.10.2020 bis 25.11.2020 (13.298,11 €), Krankengeld für den Zeitraum vom 27.10.2020 bis 25.11.2020 (2.398,88 €) sowie entgangene Krankenversicherungsbeiträge, Trägeranteile und den Zusatzbeitrag während der Zeit des empfangenen Krankengeldes (588,99 € + 558,25 € + 48,43 € = 1.195,67 €). Hinsichtlich der Hilfsmittel wurden Verordnungen bzw. Hilfsmittelempfehlungen und die jeweilige Rechnung vorgelegt. Auch für die Fahrtkosten liegt eine Verordnung vor nebst Bestätigung des Transporteurs und eine entsprechende Zuordnung zu dem Geschädigten. Für die stationäre Rehabilitationsbehandlung im Zeitraum vom 07.10.2020 bis 25.11.2020 wird die entsprechende Rechnung vorgelegt. Substantiierte Einwendungen werden nicht geltend gemacht.
Die Beklagten führten lediglich allgemein aus, dass die geltend gemachten Aufwendungen i.H.v. 111.644,15 € möglicherweise berechtigt seien, aber auch das anhand der von der Klägerin vorgelegten Unterlagen nicht mit Sicherheit festgestellt werden könne. Ein substantiiertes Bestreiten erfolgte somit nicht, sodass die Tatsachen nach § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden zu werten sind.
3. Der Zinsanspruch folgt aus §§ 286, 288 Abs. 1, 2 BGB. Die Klägerin hat Anspruch auf Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz aus einem Betrag i.H.v. 204.073,10 € für den Zeitraum vom 24.04.2021 bis 24.05.2021 sowie aus 221.567,72 € seit dem 25.05.2021.
Die Klägerin zu 1. hat der Beklagten zu 2. Schadensersatzrechnungen über die jeweiligen Beträge gestellt, in denen es heißt: „Wir erwarten Ihre Zahlung bis zum ...“.
Somit war zwar auf den Schadensersatzrechnungen ein Zahlungsziel angegeben. Es liegt jedoch kein Fall von § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB vor, der eine Mahnung entbehrlich machen könnte. Eine Mahnung ist nur entbehrlich, wenn für die Leistung durch Gesetz, Rechtsgeschäft oder Urteil eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist. Das Rechtsgeschäft erfordert eine vertragliche Vereinbarung. Eine einseitige Bestimmung durch den Gläubiger genügt hingegen nicht (Grüneberg, BGB, 81. Aufl. 2022, § 286 Rn. 22). Insofern konnte die einseitige Angabe eines Zahlungszieles von der Klägerin vorliegend eine Mahnung nicht ersetzen.
Verzug ist gemäß § 286 Abs. 3 BGB 30 Tage nach dem jeweiligen Rechnungszugang eingetreten. Die Schadensersatzrechnung der Klägerin zu 1. vom 05.10.2020 über 6.817,25 € ist der Beklagten zu 2. am 06.10.2020 zugegangen, sodass Verzug am 06.11.2020 eingetreten ist. Die Schadensersatzrechnung der Klägerin zu 1. vom 13.11.2020 über 8.808,07 € ist der Beklagten zu 2. am 14.11.2020 zugegangen, sodass Verzug am 15.12.2020 eingetreten ist. Die Schadensersatzrechnung der Klägerin zu 1. vom 27.11.2020 über 188.447,78 € ist der Beklagten zu 2. am 28.11.2020 zugegangen. Ergänzende Unterlagen wurden mit Schreiben vom 28.12.2020 und 01.04.2021 übersandt. Verzug spätestens am 01.04.2021 eingetreten. Die Schadensersatzrechnung der Klägerin zu 1. vom 22.04.2021 über 17.494,62 € ist der Beklagten zu 2. Am 23.04.2021 zugegangen, sodass Verzug am 25.05.2021 eingetreten ist.
III.
Die Feststellungsanträge - Antrag zu 2. und zu 4. - sind zulässig und begründet.
Eine Klage auf Feststellung der Verpflichtung eines Schädigers zum Ersatz künftiger Schäden ist zulässig, wenn die Möglichkeit eines Schadenseintritts besteht. Ein Feststellungsinteresse ist nur zu verneinen, wenn aus der Sicht des Geschädigten bei verständiger Würdigung kein Grund besteht, mit dem Eintritt eines Schadens zu rechnen (BGH, Urteil vom 20.03.2001, Az. VI ZR 325/99 - VersR 2001, 876 f.; BGH, Urteil vom 16.01.2001, Az. VI ZR 381/99 - VersR 2001, 874 f.).
Bei dem Geschädigten ... sind weitere materielle Schäden nicht auszuschließen. Er wurde bei dem Unfallereignis sehr schwer verletzt, was sich sowohl aus der Vielzahl der erlittenen Verletzungen und der hiermit verbundenen Operationen und der langen Krankenhausbehandlungsnotwendigkeit einschließlich intensivmedizinischer Behandlung ergibt. Insoweit wird Bezug genommen auf den 11-seitigen Arztbrief zur Krankenhausbehandlung vom 25.08.2020 bis zum 07.10.2020 (Bl. 91-101 Bd. I d.A.), gerichtet an den Chefarzt Dr. med. ... des M. Reha-Zentrum B. D.. Aufgrund der Vielzahl der erlittenen Verletzungen könnten weitere Behandlungsmaßnahmen erforderlich werden, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend erkennbar sind. Alle schweren Verletzungen können zu Folgeschäden führen. Der Geschädigte hat insbesondere auch zahlreiche Knochenbrüche erlitten. Diese können zu einer Arthrose führen. Es besteht somit die Möglichkeit, dass der Geschädigte weitere Leistungen der Klägerin zu 1. in Anspruch nimmt, insbesondere medizinische Behandlungen notwendig werden. Dadurch können weitere Kosten anfallen. Insofern besteht auch die Möglichkeit, dass erneut Krankengeldzahlungen zu erbringen sind und der Klägerin zu 1. Beiträge entgehen.
Es ist auch nicht auszuschließen, dass die erlittenen schweren Verletzungen zur Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI führen, sodass auch der Feststellungsantrag der Klägerin zu 2. begründet ist.
IV.
Die Beklagten haben der Klägerin zu 1. auch die entstandenen außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten in der beantragten Höhe von 3449,81 € zu erstatten.
Der für die Gebühr (hier die Geschäftsgebühr) maßgebliche Gegenstandswert (§ 13 RVG) bestimmt sich nach der objektiv berechtigten Forderungshöhe. Im Schreiben vom 08.06.2021 (Anlage K 12, Bl. 113 Bd. I der Akte) macht der Klägervertreter einen Betrag von 221.567,72 € geltend, welcher in diesem Verfahren auch zugesprochen wird. Somit sind vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 3.660,80 € (1,3 Geschäftsgebühr aus Streitwert Stufe bis 230.000 € i.H.v. 3056,30 € + Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen i.H.v. 20,00 € = 3076,30 € + 19 % Mwst. i.H.v. 584,50 € = 3660,80 €) entstanden.
Die Klägerin war auch berechtigt einen Rechtsanwalt zu beauftragen, zumal sich die Beklagte zu 1. zu diesem Zeitpunkt bereits in Verzug befand.
Der Zinsanspruch folgt aus §§ 291, 288 BGB.
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 BGB und berücksichtigt, dass die Zuvielforderung der Klägerin von 10,00 € sowie im Hinblick auf die Zinsen verhältnismäßig geringfügig war und keine Mehrkosten verursacht hat.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.
VI.
Der Streitwert war auf die Stufe bis 440.000,- € festzusetzen (Antrag zu 1.: 221.577,72 €, Antrag zu 2.: 150.000,00 €, Antrag zu 4.: 50.000,00 €).
Mit dem Begriff "Schadensfall" ist bei Teilungsabkommen das versicherte Risiko und nicht ein Gesundheitsschaden gemeint - OLG Bamberg, Urteil vom 21. März 2023 – 5 U 54/22 – (veröffentlicht in Recht+Schaden 2023, S. 426 sowie bei juris und beck-online)
OLG Bamberg, Urteil vom 21. März 2023 – 5 U 54/22 –, juris
(vorgehend LG Bamberg 1. Zivilkammer, 2. Februar 2022, 11 O 160/20 V
Tenor
I. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts Bamberg vom 02.02.2022, Az. 11 O 160/20 V, abgeändert:
1. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, an die Klägerin 9.543,07 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. aus 8.116,62 € seit dem 18.12.2017 und im Übrigen seit 02.07.2020 zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche weiteren Aufwendungen innerhalb des zwischen den Parteien bestehenden Teilungsabkommens mit einer Quote von 55 % zu ersetzen, die der Klägerin aufgrund der Frau ..., entstanden sind und noch entstehen werden.
3. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, der Klägerin 887,03 € vorgerichtliche Anwaltskosten nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab 02.07.2020 zu zahlen.
II. Von den Gerichtskosten des Rechtsstreits 1. Instanz tragen die Klägerin 59 %, die Beklagte zu 1) 41 %. Von den außergerichtlichen Kosten des Rechtsstreits 1. Instanz haben zu tragen: von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin die Beklagte zu 1) 41 %; von den außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) die Klägerin 17 %; die außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 2) die Klägerin. Im Übrigen tragen die Parteien die ihnen in der 1. Instanz entstandenen außergerichtlichen Kosten selbst. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Beklagte zu 1).
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Parteien können jeweils die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der jeweils andere Teil vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet.
IV. Die Revision gegen dieses Urteil wird nicht zugelassen.
Gründe
A.
Die Klägerin, eine gesetzliche Krankenkasse, verlangt - gestützt auf das am 30.07/09.08.1984 zwischen ihr und der Beklagten zu 1) abgeschlossene Rahmen-Teilungsabkommen (TA) von der Beklagten zu 1), einem Kfz-Haftpflichtversicherer, 55 % der Aufwendungen, die ihr aus Anlass eines Unfalls der bei ihr Versicherten ... entstanden sind sowie Feststellung der Ersatzpflicht für weitere Aufwendungen in Höhe von 55 %. Zu dem Verkehrsunfall am 19.11.2016 kam es, weil der Fahrer des bei der Beklagten zu 1) haftpflichtversicherten Fahrzeugs auf das verkehrsbedingt anhaltende Fahrzeug, das von der Versicherten geführt wurde, auffuhr. Die Versicherte hatte das Beklagtenfahrzeug im Rückspiegel näher kommen sehen und sich in Erwartung eines Aufpralls am Lenkrad abgestützt. Sie verspürte unmittelbar nach dem Unfall keine Beschwerden und begab sich nicht in ärztliche Behandlung. 2 Tage später traten Schmerzen im Bereich des rechten Armes bzw. der rechten Hand auf. Die Versicherte begab sich am 22.11.2016 erstmals in ärztliche Behandlung. Bei einer Untersuchung am 29.11.2016 wurde ein posttraumatischer Abriss des Tiefenblatts des triangulären fibrocartilaginären Komplexes diagnostiziert. Die Aufwendungen der Klägerin für Krankenhausaufenthalte, ärztliche Behandlungen, Therapien, Hilfsmittel, Krankengeld und Lohnersatzleistungen betragen bisher 17.366,43 €. Die Beklagte zu 1) lehnt den Ausgleich ab, weil der nach § 1a Abs. 3 TA erforderliche Kausalzusammenhang zwischen der diagnostizierten Verletzung und dem Unfall nicht vorliege. Es habe sich bei dem Unfall um einen Bagatellunfall gehandelt, bei dem nur äußerst geringe Kräfte auf den Körper der Versicherten eingewirkt hätten. Beweispflichtig sei für die Kausalität nach dem Teilungsabkommen die Klägerin.
Die maßgeblichen Regelungen des Teilungsabkommens (Anlage zum Schriftsatz des Klägervertreters vom 06.08.2020) lauten wie folgt:
㤠1a
für Schadenfälle der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
(1) Erhebt eine diesem Abkommen beigetretene Betriebskrankenkasse („K“) Schadensersatzansprüche nach § 116 SGB X gegen Kraftfahrzeughalter und -führer, die aus dem Schadenfall bei der „H“ Versicherungsschutz genießen, so erstattet die „H“ der „K“ ohne Prüfung der Haftungsfrage namens der haftpflichtversicherten Personen im Rahmen des bestehenden Haftpflichtversicherungsvertrages und nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen 55 % ihrer anlässlich des Schadensfalls aufgrund Gesetzes erwachsenen Aufwendungen.
(2) Eigenes Verschulden des Geschädigten oder das Vorliegen eines unabwendbaren Ereignisses (§ 7 Abs. 2 StVG) schließt die Erstattungspflicht der „H“ nicht aus.
(3) Voraussetzung für die abkommensgemäße Beteiligung ist jedoch das Bestehen eines adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen dem Gebrauch des Kraftfahrzeuges und dem Eintritt des Schadenfalles. (...)
§ 2
Die Aufwendungen der "K" unterliegen der Erstattung nach §§ 1a und 1b nur insoweit und solange, als sie sich mit dem sachlich und zeitlich kongruenten Schaden des Verletzten decken (Übergang nach § 116 SGB X).
§ 3
(1) Das Abkommen findet Anwendung, wenn und soweit die ”H" aus dem den Regreßansprüchen zugrundeliegenden Schadenfall Versicherungsschutz zu gewähren hat. In Fällen der Leistungsfreiheit nach § 7 V AKB ist das Teilungsabkommen anzuwenden, soweit die Aufwendungen der ”K" den jeweiligen Leistungsfreibetrag überschreiten.
(2) Unterlassene, verspätete oder nicht ordnungsgemäße Anzeige des Schadenfalles durch die haftpflichtversicherte Person bei der „H“ oder durch den Krankenversicherten bei der "K" schließt die Anwendung des Abkommens nicht aus.
(3) § 156 Abs. 3 VVG wird durch das Abkommen nicht berührt. (...)
§ 6
(...)
(3) Alle anderen durch den Schadenfall verursachten Aufwendungen der "K” wie z. B. für:
(...) werden in tatsächlicher Höhe berücksichtigt, wenn und soweit die zugrundeliegenden Regreßansprüche nach § 2 auf die ”K” übergegangen sind.“
Die Klägerin hat nach Rücknahme ihrer gegen den Beklagten zu 2) als Fahrer des bei der Beklagten zu 1) haftpflichtversicherten Fahrzeugs und nach Teilrücknahme ihrer gegen die Beklagte zu 1) gerichteten Klage die im Ersturteil wiedergegebenen Anträge gestellt. Es wird auf den Tatbestand des Urteils des Landgerichts Bamberg vom 02.02.2022 verwiesen. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass nach dem Teilungsabkommen die Klägerin den erforderlichen Kausalzusammenhang zwischen der diagnostizierten Verletzung und dem Unfall zu beweisen habe. Diesen Beweis habe sie nicht angetreten, sie sei beweisfällig geblieben. Es wird auf die Urteilsgründe Bezug genommen. Mit der Berufung verfolgt die Klägerin die erstinstanzlich zuletzt gestellten Klageanträge weiter. Sie wendet sich gegen die vom Landgericht vorgenommene Auslegung des Teilungsabkommens. Das Landgericht habe das Trennungsprinzip zwischen der Deckungspflicht und der Haftpflichtfrage nicht hinreichend beachtet und deshalb Sinn und Zweck des Teilungsabkommens nicht zutreffend erfasst. Dieser liege in der Kosten- und Zeitersparnis in Massenverfahren durch den Verzicht auf die Prüfung der Haftungsfrage. Auch dem streitgegenständlichen Teilungsabkommen liege ein umfassender Haftungsprüfungsverzicht zugrunde. Hierzu gehöre auch die haftungsausfüllende Kausalität. Müsste in Massengeschäften das Vorliegen der haftungsausfüllenden Kausalität jeweils kosten- und zeitintensiv geprüft werden, wäre das Teilungsabkommen sinnlos. Das Teilungsabkommen sei im Streitfall bereits dann anwendbar, wenn der Schadenfall seiner Art nach zum versicherten Wagnis gehöre und der Versicherer im konkreten Fall Versicherungsschutz zu gewähren habe. Beide Voraussetzungen seien erfüllt. Damit bestünde ein Anspruch der Klägerin auf 55 % der aufgewendeten Kosten. Die Auslegung des Landgerichts, der Schadenfall im Sinne von § 1a Abs. 3 TA betreffe das Vorliegen einer Körperverletzung, sei fehlerhaft. Hiermit hätten die Parteien vielmehr das versicherte Risiko gemeint. Es wird auf die Berufungsbegründung vom 03.05.2022 (Bl. 189 ff. d. A.) verwiesen.
Die Klägerin beantragt:
1. Das am 02.02.2022 verkündete Urteil des Landgerichts Bamberg, Az. 11 O 160/20 V wird abgeändert.
2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 9.543,07 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. aus 8.116,62 € seit dem 18.12.2017 und im Übrigen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
3. Es wird festgestellt, dass die Beklagte darüber hinaus verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche weiteren Aufwendungen innerhalb des zwischen den Parteien bestehenden Teilungsabkommens mit einer Quote von 55 % zu ersetzen, die der Klägerin aufgrund ..., entstanden sind und noch entstehen werden.
4. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin 887,03 € vorgerichtliche Anwaltskosten ihres jetzigen Prozessbevollmächtigten nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagte beantragt Zurückweisung der Berufung.
Sie verteidigt das Ersturteil. Das Teilungsabkommen sei als zwischen Versicherern geschlossener Vertrag auslegungsbedürftig. Die Ausführungen des Bundesgerichtshofs im Urteil vom 12.06.2007 - VI ZR 110/06 zur Frage, was unter dem Begriff „Schadenfall“ zu verstehen sei, seien auf den Streitfall nicht zu übertragen, weil Gegenstand der dortigen Auslegung ein anderes Teilungsabkommen gewesen sei. Die von der Klägerin gewünschte Auslegung des Teilungsabkommens sei nicht interessengerecht. Sie laufe auf Zahlungsverpflichtungen der Beklagten zu 1) auf „Zuruf“ hinaus. Diese könne - abgesehen von Groteskfällen - auch offensichtlich unbegründete Forderungen nicht abwehren. Für die Auffassung der Beklagten zu 1), wonach die Klägerin gemäß § 1a Abs. 3 TA eine durch den Unfall verursachte Körperverletzung nachzuweisen habe, spreche die systematische Ausgestaltung des Teilungsabkommens. Während in § 2 ausgeführt werde, dass der Erstattung nach den §§ 1a und 1b TA Aufwendungen der Krankenkasse nur insoweit unterliegen, als sie sich mit dem sachlichen und zeitlichen kongruenten Schaden des Verletzten decken, enthalte § 6 Abs. 3 TA die Regelung, dass die dort genannten Aufwendungen der Krankenkasse nur dann berücksichtigt würden, wenn und soweit die zugrunde liegenden Regressansprüche nach § 2 TA auf die Krankenkasse übergegangen seien. Die Formulierung zeige deutlich, dass die Parteien davon ausgegangen seien, dass eine Kausalität nachzuweisen sei. Anders lasse sich die Verwendung des Indikativs nicht erklären. Hätten die Parteien in § 1a Abs. 1 TA einen umfassenden Haftungsprüfungsverzicht regeln wollen, wären auch die Regelungen in § 1a Abs. 3 TA zur adäquaten Kausalität und § 1a Abs. 2 TA zur Unabwendbarkeit und zum Verschulden des Geschädigten überflüssig. Gegen einen umfassenden Haftungsprüfungsverzicht spreche darüber hinaus die Regelung in § 3 TA, wonach das Teilungsabkommen Anwendung finde, solange und soweit Versicherungsschutz besteht. Diese Regelung wäre überflüssig, wenn die Haftung der Beklagten zu 1) keine Rolle spielen würde. Es wird auf die Berufungserwiderung vom 22.07.2022 (Bl. 218 ff. d. A.) und die weiteren im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze verwiesen.
B.
Die zulässige Berufung der Klägerin hat Erfolg. Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 9.543,07 € nebst vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 887,03 € jeweils nebst Zinsen sowie Feststellung aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Teilungsabkommen.
I.
Entgegen der Ansicht des Landgerichts ist das Teilungsabkommen nicht dahingehend auszulegen, dass der Eintritt des adäquat kausalen Schadensfalls den Nachweis einer unfallbedingten Verletzung der Versicherten erfordert. Das Teilungsabkommen ist dahingehend auszulegen, dass ein Verzicht auf die Prüfung der Haftungsfrage vereinbart wurde, von dem auch der Nachweis des Ursachenzusammenhangs zwischen Unfallereignis und Verletzung umfasst ist.
Das hier vorliegende Teilungsabkommen ist ein Vertrag, der der Auslegung dahingehend unterliegt, dass vom Wortlaut ausgehend der Sinngehalt der Regelungen unter Berücksichtigung der Interessenlage der Vertragspartner im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ermittelt wird (BGH, Urt. v. 12.06.2007 - VI ZR 110/06, Rn. 10).
Der Senat geht bei seiner Auslegung davon aus, dass die Wortwahl im Teilungsabkommen dem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses üblichen Sprachgebrauch im Rechtsverkehr zwischen Versicherern entspricht. Danach ist der Begriff "Schadenfall" in Teilungsabkommen im Zusammenhang mit dem versicherten Wagnis zu verstehen (vgl. BGH, Urt. v. 12. Juni 2007 aaO, Rn. 11). Bei Kraftfahrzeugunfällen umfasst das versicherte Wagnis nach § 10 AKB die Befriedigung begründeter und die Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche, die aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer oder gegen mitversicherte Personen erhoben werden, wenn durch den Gebrauch des Fahrzeugs Personen-, Sach- oder Vermögensschäden herbeigeführt werden. Dementsprechend ist im Streitfall nach § 1a Abs. 3 TA Voraussetzung für die Anwendung des Teilungsabkommens der adäquate Kausalzusammenhang zwischen "dem Schadenfall und dem Gebrauch eines Kraftfahrzeugs". Hierdurch soll gewährleistet sein, dass der Haftpflichtversicherer nur in Fällen zu zahlen hat, in denen er zur Deckung verpflichtet sein kann. Andererseits kann die Krankenkasse Ausgleichsansprüche geltend machen, sofern es im Zusammenhang mit dem Gebrauch eines Kraftfahrzeugs zu einem Personenschaden des Krankenversicherten gekommen ist, für den die Krankenkasse Kosten aufgewendet hat (vgl. BGH, Urt. v. 12. Juni 2007 aaO, Rn. 11). Der Begriff des Schadenfalles bezieht sich somit ausschließlich auf das Schadensereignis als solches und ist nicht gleichzusetzen mit den unfallbedingt hervorgerufenen Folgen und Auswirkungen, die das Unfallgeschehen nach sich zieht.
Gegen das Verständnis des Landgerichts und der Berufungserwiderung spricht, dass die Parteien den Begriff „Schadenfall“ im Teilungsabkommen an verschiedenen Stellen verwenden (vgl. z. B. § 1a in der Überschrift, § 1a Abs. 1, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 3 und § 9 Abs. 1). Anhaltspunkte dafür, dass die Vertragsparteien unter dem Begriff „Schadenfall“ dabei unterschiedliches verstanden hätten, sind nicht ersichtlich und werden auch nicht behauptet. An diesen Stellen wird der Begriff aber unzweifelhaft im Sinne des versicherten Wagnisses verwendet und nicht im Sinne von Körperverletzung oder dem Eintritt eines Gesundheitsschadens. Diese Begriffe würden zahlreichen der oben genannten Regelungen keinen Sinn verleihen.
Entgegen der Auffassung der Beklagten zu 1) enthalten § 3 Abs. 1 und § 6 Abs. 3 TA keine Einschränkung des Verzichts auf die Prüfung der Haftungsfrage. Nach § 3 Abs. 1 TA, auf den § 6 Abs. 3 TA Bezug nimmt, unterliegen die Aufwendungen der Klägerin der Erstattung nach §§ 1a und 1b nur insoweit und so lange, als sie sich mit dem sachlich und zeitlich kongruenten Schaden des Verletzten decken (Übergang nach §§ 116 SGB X). Dies ist so zu verstehen, dass damit der Einwand der mangelnden zivilrechtlichen Übergangsfähigkeit behandelt wird. Dies betrifft weder die Haftungsfrage noch die Deckungsfrage, sondern die Frage, ob der Sozialversicherungsträger gemäß § 116 SGB X zur Geltendmachung des Anspruchs des Geschädigten berechtigt ist. Zu prüfen ist deshalb nur, ob der Anspruch, wenn er bestünde, gemäß § 116 SGB X auf den Sozialversicherungsträger übergegangen wäre (BGH, Beschl. v. 20.09.2011 - VI ZR 337/10).
Auch der systematische Aufbau des Teilungsabkommens spricht nicht für die Auslegung der Beklagten zu 1). Die Regelung in § 2 TA, wonach eigenes Verschulden des Geschädigten oder die Unabwendbarkeit im Sinne des § 7 Abs. 2 StVG die Erstattungspflicht der Beklagten zu 1) nicht ausschließt, ist im Kontext mit § 1a Abs. 3 TA zu sehen. Die Parteien haben mit der dortigen Regelung und der Begrenzung auf adäquat kausale Schadenfälle offensichtlich die „Groteskfälle“ von der Erstattungspflicht ausgenommen. Dabei handelt es sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um Fälle, die schon aufgrund des unstreitigen Sachverhalts unzweifelhaft und offensichtlich eine Schadensersatzpflicht des Versicherungsnehmers nicht hervorrufen können und daher gemäß § 242 BGB von der Erstattungspflicht ausgenommen sind (BGH NJW 1956, 1237). Die Gegenausnahme ist in § 2 TA enthalten und dient ersichtlich nur der Klarstellung. Der Bundesgerichtshof hat bereits mit Urteil vom 23.09.1963 - II ZR 118/60 entschieden, dass durch den im dortigen Teilungsabkommen vereinbarten Verzicht auf die Prüfung der Haftungsfrage nach dem Willen der Vertragsschließenden auch ein auf § 7 Abs. 2 StVG gestützter Einwand des Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherers ausgeschlossen sein soll. Dies haben die Parteien im Streitfall klargestellt. Weiter haben sie in § 2 TA klargestellt, dass auch eigenes Verschulden des Geschädigten die Erstattungspflicht der Beklagten zu 1) nicht ausschließt.
Entgegen der Auffassung der Beklagten zu 1) sprechen gegen den in § 1a Abs. 1 TA geregelten umfassenden Verzicht auf die Prüfung der Haftungsfrage auch nicht die Regelungen in § 3 TA. Diese sind auch bei Annahme eines umfassenden Verzichts auf die Prüfung der Haftungsfrage nicht überflüssig. Vielmehr werden an dieser Stelle die weiteren Voraussetzungen der Deckungspflicht, insbesondere die Leistungsfreiheit nach § 7 Abs. 5 AKB und die Auswirkungen von Obliegenheitsverletzungen behandelt.
Die Auslegung des Teilungsabkommens ergibt somit, dass dessen Anwendungsbereich bereits dann eröffnet ist, wenn der Anspruch, sein Bestehen unterstellt, unter das versicherte Wagnis fallen würde (vgl. auch BGH, Urt. v. 01.10.2008 - IV ZR 285/06). Ob der Anspruch begründet ist, also der Geschädigte unfallbedingte Verletzungen davongetragen hat, ist dagegen unerheblich, weil es dabei um die Haftungsfrage geht, auf deren Prüfung die Parteien verzichtet haben. Der in § 1a Abs. 3 TA geregelte adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Schadenfall und dem versicherten Haftpflichtbereich betrifft allein die Deckungspflicht.
Der ermittelte Sinngehalt des Teilungsabkommens wird auch der Interessenlage der Parteien gerecht. Zur Herbeiführung einer Haftungseinschränkung hätte es den Parteien freigestanden, entsprechend dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Sachverhalt (BGH, Urt. v. 12.06.2007 - VI ZR 110/06) eine Vereinbarung dergestalt in das Teilungsabkommen aufzunehmen, dass die Beklagte zu 1) berechtigt ist, von der Klägerin im Zweifelsfall den Nachweis des Ursachenzusammenhangs zwischen dem Schadensfall und dem der Kostenforderung zugrunde liegenden Krankheitsfall zu verlangen. Eine solche Einschränkung enthält das Teilungsabkommen vorliegend indes nicht. Wäre es der Beklagten zu 1) gleichwohl gestattet, sich auf das Fehlen eines Ursachenzusammenhangs zwischen Schadensereignis und körperlicher Beeinträchtigung zu berufen, würde das Abkommen letztlich konterkariert werden, da die Beklagte zu 1) durch die Behauptung, die zu regressierenden Aufwendungen beinhalteten keinen unfallbedingt hervorgerufenen Ersatzanspruch, stets auf die Einholung eines Gutachtens hinwirken und ihre Zahlung von dem Nachweis der Ursächlichkeit abhängig machen könnte. Der Sinn der Vereinbarung, die Kosten einer gerichtlichen oder außergerichtlichen Prüfung der Haftpflicht zu vermeiden, indem allen zwischen den Beteiligten vorzunehmenden Schadensregulierungen eine einheitliche, der Erfahrung nach als Durchschnittswert anzusehende Quote zugrunde gelegt wird, wäre damit infrage gestellt. Eine ohne Prüfung der Haftungsfrage bestehende Einstandspflicht des Haftpflichtversicherers führt auch nicht zu einer massiven Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts, die das Leistungsvermögen der Beklagten zu 1) als Haftpflichtversicherer gefährden könnte. Die Tatsache, dass die Haftungsfrage bei Eingreifen des Teilungsankommens nicht geprüft wird, wirkt sich je nach Fallgestaltung auch zu Gunsten der Beklagten zu 1) aus. Selbst wenn der bei der Beklagten zu 1) Haftpflichtversicherte den Unfall zu 100 % verursacht hätte, hat die Klägerin lediglich die Möglichkeit, 55 % der ihr entstandenen Aufwendungen zu regressieren.
II.
Die Voraussetzungen für die Anwendung des Teilungsabkommens liegen im Streitfall vor. Der in § 1a Abs. 3 TA genannte Zusammenhang ist gegeben. Das bei der Beklagten zu 1) versicherte Fahrzeug fuhr auf das verkehrsbedingt stehen gebliebene Fahrzeug der Versicherten auf. Ein solcher Verkehrsvorgang liegt auch nicht außerhalb der allgemeinen Verkehrserfahrung, sondern ist typisch. Das von der Versicherungsnehmerin gefahrene Fahrzeug war nach der Verkehrsauffassung an diesem Verkehrsvorgang aktuell und unmittelbar, zeit- und ortsnah beteiligt. Für die Anwendung des § 10 AKB sowie des TA kommt es auch nicht darauf an, ob der Fahrer des haftpflichtversicherten Wagens sich verkehrsgerecht verhalten hat.
Auch die weiteren Voraussetzungen der Deckungspflicht nach § 3 TA liegen vor.
III.
Die Beklagte zu 1) hat im Rahmen des § 1a TA 55 % der erbrachten Aufwendungen zu tragen. Dies sind unstreitig 9.551,54 €. Bei den geltend gemachten, in der Regresskostenaufstellung der Klägerin gelisteten Kosten handelt es sich auch um übergangsfähige Kosten im Sinne des § 116 Abs. 1 SGB X.
Die Klägerin hat auch einen Anspruch auf Feststellung der weitergehenden Ersatzpflicht. Dieser Anspruch besteht nicht unbegrenzt und unbedingt, sondern - wie beantragt - nur im vertraglich vorgesehenen Umfang.
IV.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) auch einen Anspruch auf die zugesprochenen Zinsen und die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten gemäß §§ 286 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 3, 288 Abs. 1 BGB. Die Beklagte zu 1) hat durch ihr Schreiben vom 13.12.2017 die Begleichung der zum damaligen Zeitpunkt geltend gemachten Kosten in Höhe von 8.116,62 und eine Einstandspflicht abgelehnt. Sie befindet sich daher spätestens seit Zugang dieses Schreibens bei der Klägerin in Höhe von 8.116,62 € in Verzug.
Im Übrigen stehen der Klägerin ab 02.07.2020 Prozesszinsen gem. §§ 291 Abs. 1, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB zu.
Aufgrund der Erfüllungsverweigerung konnte die Klägerin zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung auch ihre Prozessbevollmächtigten bereits vorgerichtlich beauftragen. Hinsichtlich der zutreffenden Berechnung der Anwaltskosten nach dem RVG wird auf die Klageschrift (Bl. 34 d. A.) verwiesen.
Der Anspruch auf die Prozesszinsen auf die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten ergibt sich aus §§ 291 Abs. 1, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB.
C.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 S. 1, § 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.
Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.