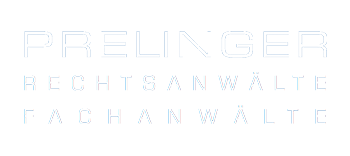Autor
Wolfdietrich Prelinger, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht, Fachanwalt für Versicherungsrecht
Erscheinungsdatum
1. Januar 2021
Fundstelle
Versicherungsrecht 2021, S. 12 ff.
Zitiervorschlag
Prelinger – Teilungsabkommen in der Regulierungspraxis zwischen SVT und Haftpflichtversicherern, VersR 2021, S. 12 ff.
Ähnliche Artikel
Unzulässigkeit der isolierten Drittwiderklage des beklagten Schädigers gegen die geschädigte Versicherungsnehmerin bei Regressen von Sozialversicherungsträgern nach § 116 Abs. 1 SGB X – Prelinger, jurisPR-VerkR 10/2018 Anm. 2 (Anmerkung zu LG Stuttgart, Urteil vom 15.12.2017 – 21 O 300/17)
16. Mai 2018AufsätzeDrittwiderklage
Der Zulässigkeit der isolierten Drittwiderklage steht entgegen, dass es nicht mit prozessökonomischen Erwägungen zu vereinbaren ist, den auf § 116 Abs. 1 SGB X gestützten Rechtsstreit einer gesetzlichen Krankenkasse gegen den Schädiger auf Erstattung von Behandlungskosten im Hinblick auf den gesetzlichen Forderungsübergang mit der Klärung von Fragen zu belasten, die für etwaige Schmerzensgeldansprüche des Geschädigten gegen den Schädiger von Belang sind.
Zivilrechtlicher Regress der gesetzlichen Unfallversicherung nach § 110 SGB VII – Prelinger, jurisPR-VersicherungsR 9/2016, Anm. 3 (Anmerkung zu OLG Naumburg, Urteil vom 20.10.2014 – 12 U 79/14)
4. Oktober 2016Aufsätzegesetzliche Unfallversicherung,Mitverschulden
Die Anerkennung eines Verkehrsunfalls als Arbeitsunfall durch den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bindet den nach § 110 SGB VII regresspflichtigen Arbeitskollegen sowie die ebenfalls haftende Kfz-Haftpflichtversicherung nur, wenn sie nach § 12 Abs. 2 SGB X am Verfahren beteiligt waren. Für den Regress des Unfallversicherungsträgers kommt es auf diese den Interessen des Geschädigten folgende Bindung aber auch nicht an, so dass der Prozess nicht nach § 108 Abs. 2 SGB VII auszusetzen ist, soweit sich der Schädiger zu seinen Gunsten nur auf die Haftungsprivilegierungen der §§ 104 ff. SGB VII beruft. Das Zivilgericht hat dann ausnahmsweise das Vorliegen eines Arbeitsunfalls und des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes selbstständig zu prüfen (OLG Naumburg, Urteil vom 20.10.2014, Az. 12 U 79/14).
Kein Vorrang der Leistungsklage bei fortbestehenden Personenschäden – Prelinger, jurisPR-MedizinR 6/2016, Anm. 4 (Anmerkung zu BGH, Urteil vom 19.04.2016 – VI ZR 506/14)
23. Juni 2016AufsätzeSpätfolgen
Der Kläger ist nicht gehalten, seine Klage in eine Leistungs- und in eine Feststellungsklage aufzuspalten, wenn bei Klageerhebung ein Teil des Schadens schon entstanden, die Entstehung weiteren Schadens aber noch zu erwarten ist. Einzelne bei Klageerhebung bereits entstandene Schadenspositionen stellen lediglich einen Schadensteil in diesem Sinne dar. Es besteht kein Vorrang der Leistungsklage (BGH, Urteil vom 19. April 2016, Az. VI ZR 506/14).